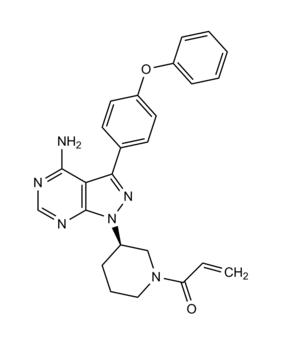Die häufigsten Nebenwirkungen in den Zulassungsstudien zu Ibrutinib waren Durchfall, Neutropenie, muskuloskelettale Schmerzen, Hautausschlag, Blutungen/Blutergüsse, Thrombozytopenie, Übelkeit, Fieber, Arthralgie und Infektionen der oberen Atemwege. Die häufigsten Nebenwirkungen des Grades 3 und 4 waren Neutropenie, Lymphzytose, Thrombozytopenie, Pneumonie und Hypertonie.
Bei einigen in den Studien mit Ibrutinib behandelten Patienten trat eine Leukostase auf. In diesem Fall sollte die Therapie vorerst unterbrochen und bei Bedarf eine Hydratation und/oder Leukopherese eingeleitet werden. Insgesamt sollte jedoch laut Fachinformation ein Anstieg der Lymphozytenzahlen beim Fehlen anderer klinischer Befunde nicht als Zeichen für ein Fortschreiten der Erkrankung gesehen werden. Sie tritt vor allem zu Therapiebeginn bei etwa drei Viertel der CLL-Patienten sowie bei einem Drittel der MCL-Patienten auf, ist reversibel und geht mit einer Reduktion der Lymphadenopathie einher.
Des Weiteren wurden in der Ibrutinib-Gruppe vermehrt Infektionen einschließlich Neutropenie beobachtet. Die Patienten sollten daher auf Fieber, Neutropenie und Infektionen überwacht werden. Alle Patienten sollten während der Einnahme regelmäßig auf Vorhofflimmern getestet werden, da unter Ibrutinib sowohl Flimmern als auch Flattern auftraten. Unter der Behandlung wurde in einer der Zulassungsstudien eine leichte Verkürzung des QTcF-Intervalls beobachtet. Zwar ist die klinische Relevanz bislang unbekannt, dennoch ist Vorsicht geboten bei Patienten mit entsprechender Disposition.