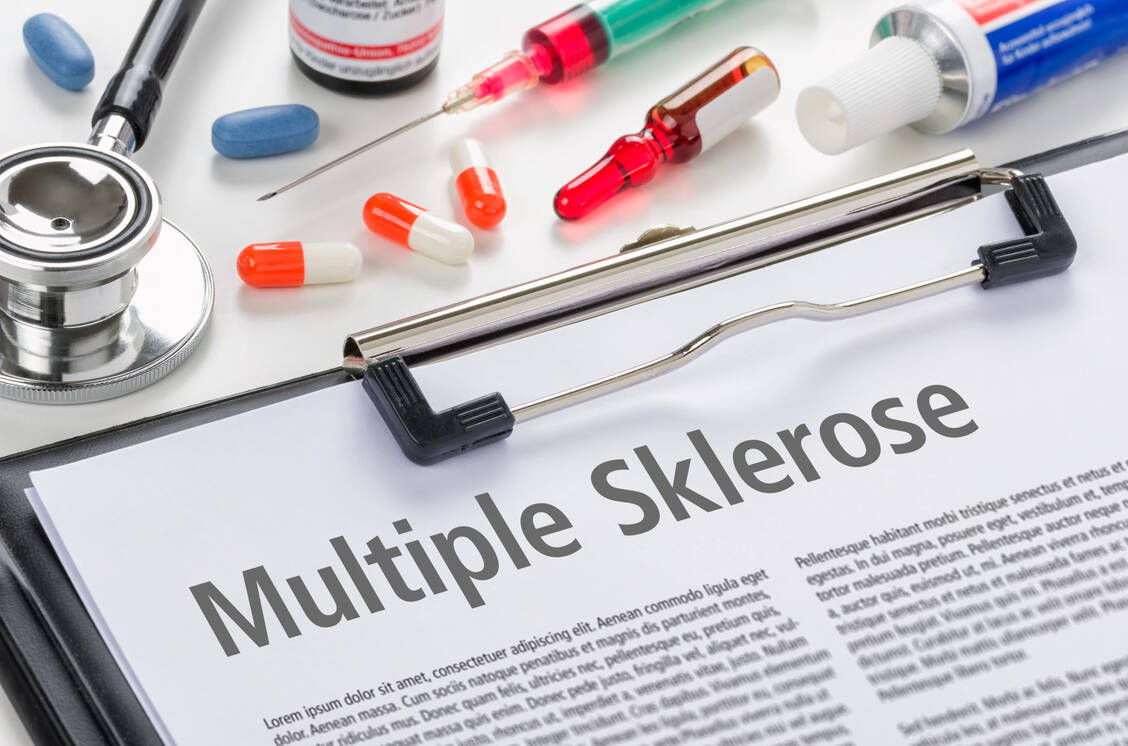Drei wichtige MS-Verlaufsformen werden unterschieden: die schubförmig remittierende MS (RRMS), die sekundär progrediente MS (SPMS) und die primär progrediente MS (PPMS). Kowarik: »Etwa 80 Prozent der Betroffenen haben zunächst eine RRMS. Diese geht unbehandelt bei 50 Prozent dieser Patienten in eine SPMS über.«
Zum Glück habe sich bei den Therapieoptionen in den vergangenen Jahren einiges getan , sodass heute zahlreiche wirksame MS-Therapien zur Verfügung stehen. Die initiale schubförmige Phase könne gut
kontrolliert und behandelt werden und die progrediente Phase dadurch verhindert oder zumindest verzögert werden. Letztgenannte könne dagegen bislang nur schlecht behandelt beziehungsweise aufgehalten werden. Kowarik betonte, dass die Tendenz in der Therapie heute klar in Richtung »hit hard and early« geht, das heißt frühzeitig hochwirksame MS-Therapeutika einzusetzen.