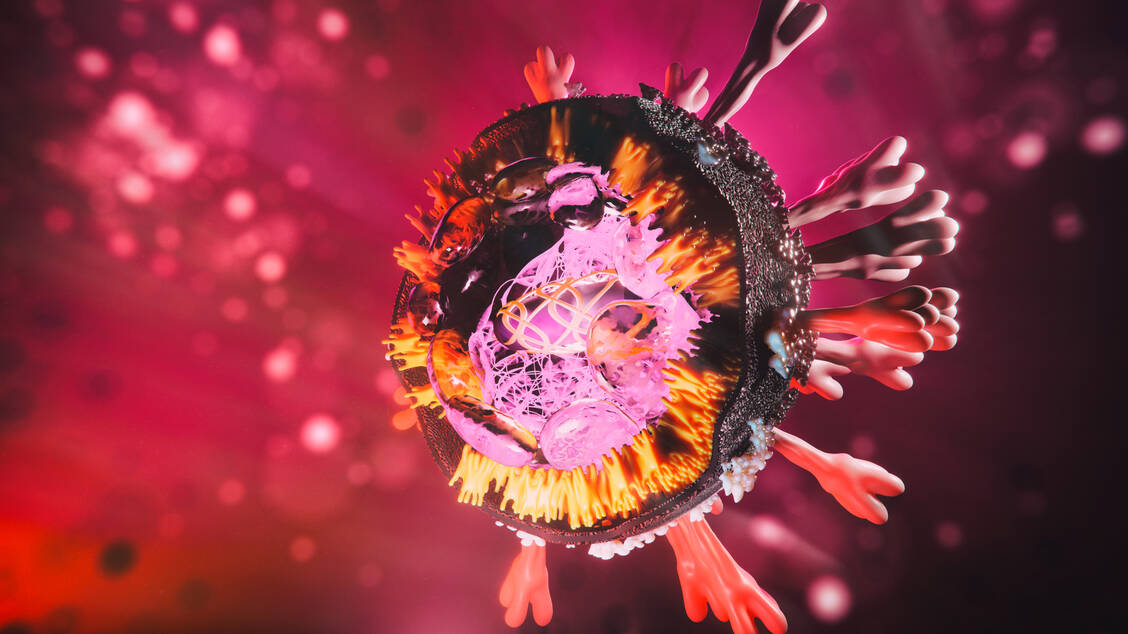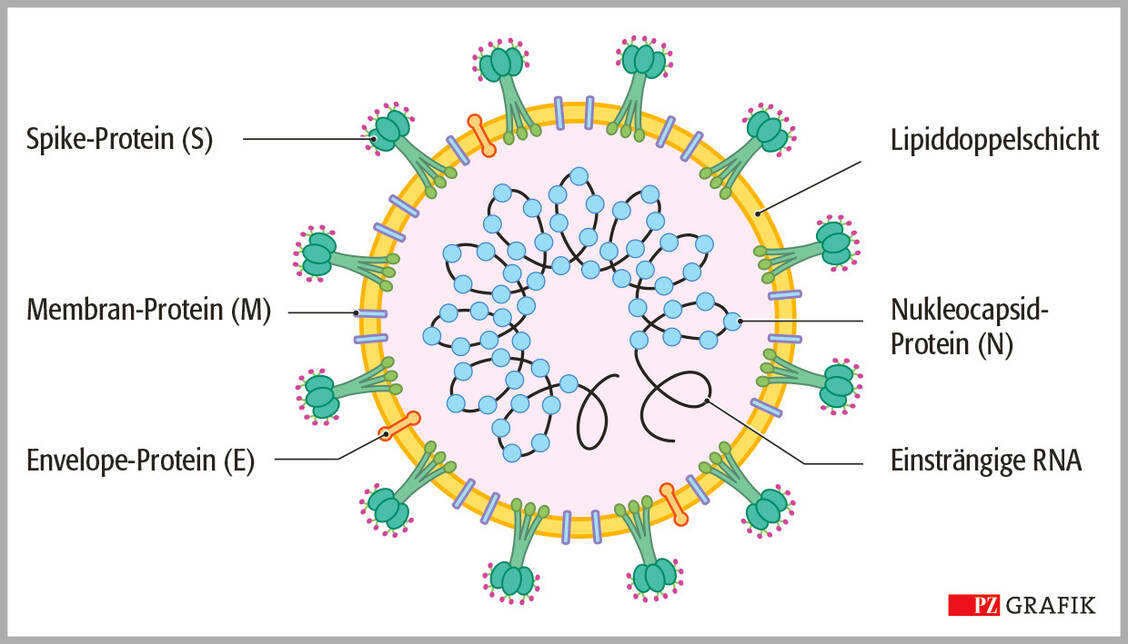Viel Aufmerksamkeit zog Remdesivir (Veklury®) auf sich. Doch das Prodrug hat deutliche Schwächen: Die Synthese ist hoch komplex und es muss intravenös appliziert werden. In vivo wird Remdesivir gespalten, bevor es in die Wirtszelle aufgenommen wird, und dann intrazellulär stufenweise in ein Triphosphat umgewandelt, das die virale Polymerase hemmt.
Die Datenlage bezeichnete der Referent als »übersichtlich gut«. Nach ernüchternden Ergebnissen einer großen Studie veröffentlichten das National Institute of Health und die Firma Gilead Daten der Adaptive Covid-19 Treatment-Trial (ACTT) mit 1000 Patienten. Demnach habe Remdesivir den Zustand der Patienten schneller gebessert als Placebo (elf versus 15 Tage), aber keinen signifikanten Vorteil bei der Sterblichkeit gebracht. Auf Basis dieser Daten habe die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA eine Notfallzulassung erteilt, sodass Remdesivir nun auch außerhalb von Studien eingesetzt werden darf.