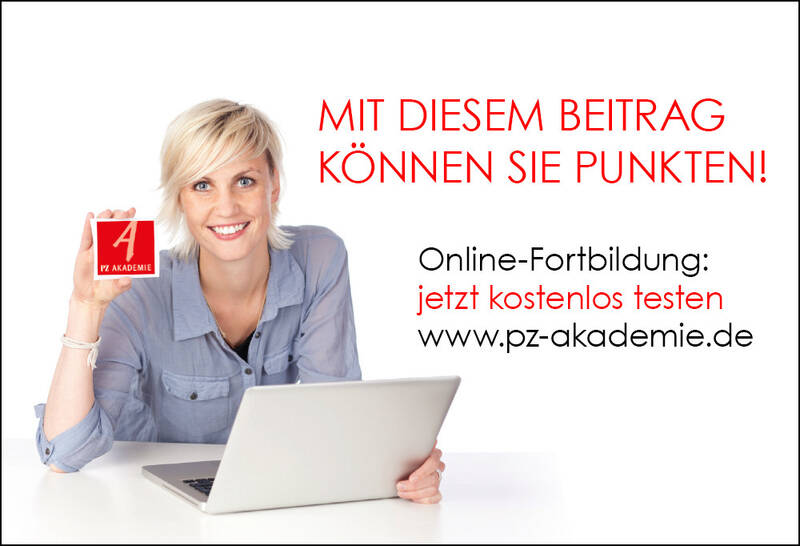Das RLS ist zwar nicht lebensbedrohlich, doch mindert es die Lebensqualität enorm. Der Leidensdruck für Betroffene ist hoch. Die Apotheke kann sie in vielerlei Hinsicht unterstützen. Menschen, die unter dem RLS leiden, sich aber noch nicht in ärztlicher Behandlung befinden, versuchen oftmals, die Beschwerden in Eigenregie mit Vitaminpräparaten, Nahrungsergänzungsmitteln oder Hypnotika zu lindern. Dann ist die Apotheke eine niederschwellige Anlaufstelle. Denkt das Apothekenpersonal in solchen Fällen an das RLS und fragt nach Missempfindungen in den Beinen sowie Beschwerden in Ruhe und Besserung unter Bewegung, kann es Betroffene gegebenenfalls frühzeitig an einen Arzt verweisen. Außerdem spielen Apotheker eine wichtige Rolle in der Therapiebegleitung, dienen als Ansprechpartner bei Nebenwirkungen und können Patienten beim Therapiemanagement beistehen. Auch die erweiterte Medikationsberatung ist ein wichtiges Angebot für Menschen mit RLS, da diese häufig mehr als fünf Arzneimittel in der Dauermedikation einnehmen.