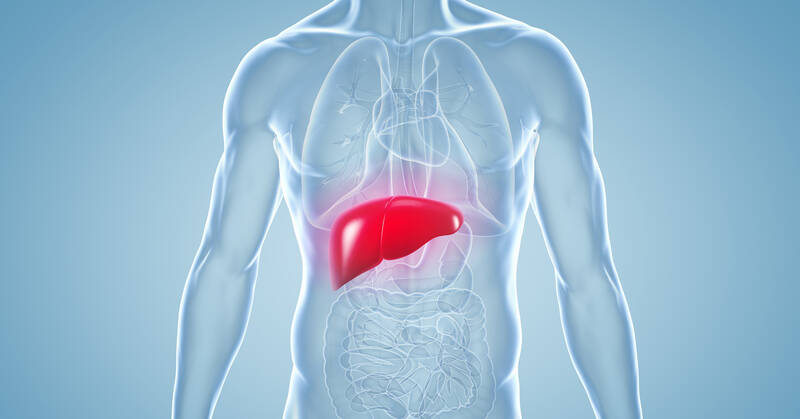Eingeteilt werden die Stadien der Leberzirrhose nach dem Child-Pugh-Score (benannt nach den beiden Beschreibern). Dieser beinhaltet die Werte von Albumin und Bilirubin, die Menge an Aszites, das Vorhandensein einer hepatischen Enzephalopathie und den Quick-Wert (oder INR). Eine leichte Zirrhose besteht im Stadium A, während ein Score von C die höchste Kategorie darstellt.
Dabei geben die Stadien nicht, wie häufig angenommen, direkt den Grad der Lebereinschränkung an, sondern prognostizieren die Ein-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit der Patienten. Diese liegt im Stadium A bei nahezu 100 Prozent, während im Stadium C die Sterblichkeitsrate nach einem Jahr bei über 60 Prozent liegt.
Eine Aussage über die Verstoffwechselungskapazität der Leber für Arzneistoffe kann mit der Child-Pugh-Kategorisierung allgemein nicht getroffen werden. Der Score ist nicht als quantitativer Marker für eine Dosisanpassung von Arzneistoffen geeignet. Nur in Einzelfällen liegen Daten zur Dosisanpassung anhand des Scores oder des Bilirubin-Werts vor.