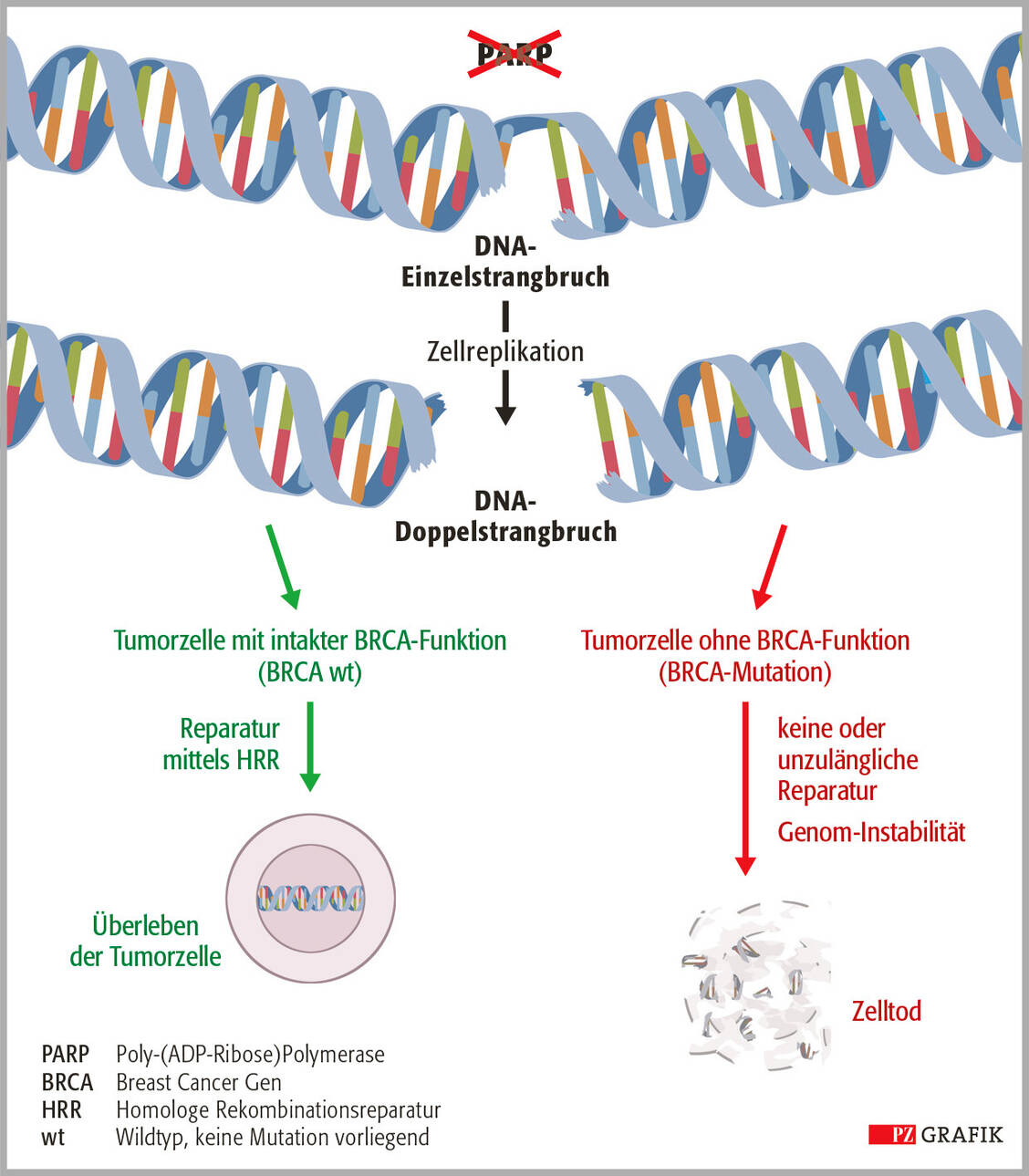Die Mehrheit der Patientinnen erleidet ein Rezidiv. Vor allem nach dem Zeitpunkt der Progression nach Ende der initialen Therapie unterscheiden Ärzte in platinsensitive und platinresistente Redizive (Tabelle). In die Entscheidung über die weitere Therapie sollte man jedoch auch Alter, Belastbarkeit und Präferenz der Patientin, genetische Aspekte und die Art der Vortherapie einbeziehen.
Beim platinsensitiven Rezidiv ist eine Verlängerung des progressionsfreien und auch des Gesamtüberlebens das Ziel. Die Frauen erhalten eine weitere platinhaltige Chemotherapie. Als Kombinationspartner für Carboplatin kommen Gemcitabin oder Paclitaxel infrage (18, 19). Auch pegyliertes liposomales Doxorubicin kommt zum Einsatz, ist allerdings für diese Indikation nicht zugelassen. Gibt es keine Vortherapie mit einem VEGF-Inhibitor, verabreicht man zusätzlich Bevacizumab.