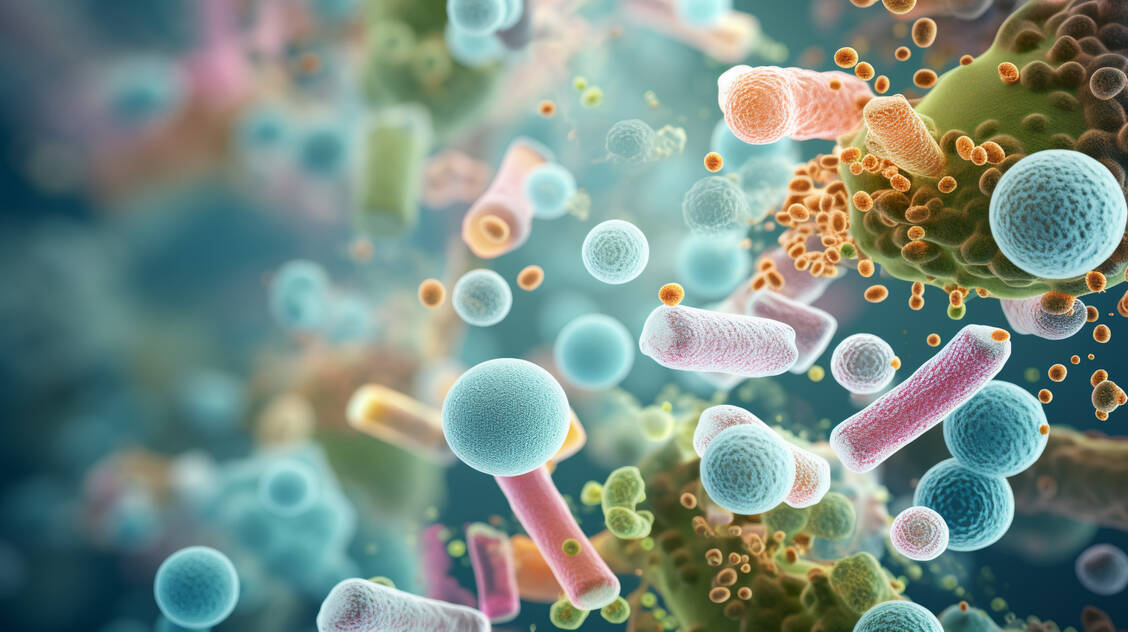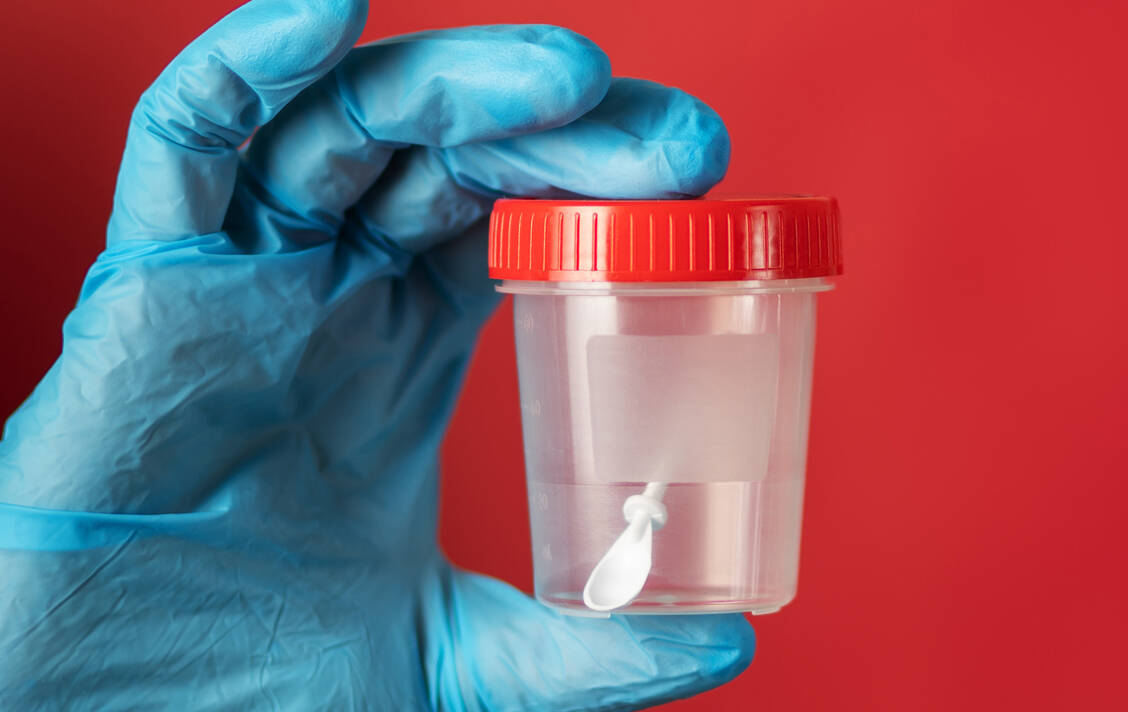Nahrungsmittel, die durch Enzyme oder Mikroorganismen haltbar gemacht wurden, können eine bestehende Darmflora verändern und damit auch den Stoffwechsel beeinflussen. Dazu gehören etwa Naturjoghurt, Kefir, Kombucha, Miso, Apfelessig sowie fermentierte Gemüsearten wie Sauerkraut oder Kimchi. Sie enthalten neben erwünschten Mikroorganismen wie Milchsäurebakterien oder Hefen auch Substanzen, die durch die Fermentation entstanden sind. So zum Beispiel Lactat, das eine chemische Barriere bildet und so das Eindringen von Krankheitserregern verhindert.
Die Aufnahme von täglich 30 Gramm Ballaststoffen fördert das Wachstum und die Aktivität von Bifido- und Laktobakterien. Geeignet sind Obst mit wenig Fruchtzucker, Gemüse und Vollkornprodukte. Auch entzündungshemmende Omega-3-Fettsäuren aus Ölsaaten, zum Beispiel Lein- oder Hanfsamen, Nüssen und fettreichem Fisch fördern die Diversität des Mikrobioms. Langfristig stabile Veränderungen sind allerdings erst nach Monaten sichtbar.