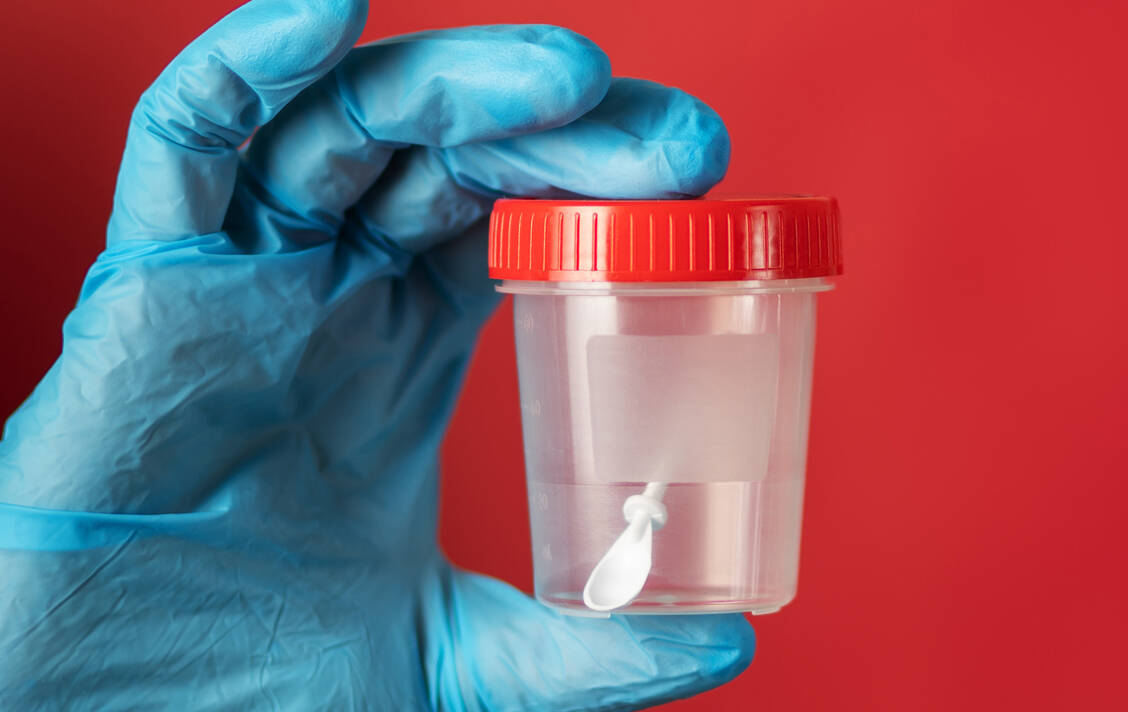Eine solche Analyse kann zwar Hinweise auf die Besiedlung geben, allerdings ist eine optimale Zusammensetzung nicht bekannt und zudem von Person zu Person unterschiedlich. Da zudem weniger die Zusammensetzung als die Funktion des Mikrobioms von Bedeutung ist, rät die DGVS von solchen Selbsttests ab. Zudem bleiben bei den Selbsttests das Virom (durch Viren gebildetes Mikrobiom) und das Mykom (durch Pilze gebildetes Mikrobiom) unbeachtet.
Insgesamt sind kommerzielle Analysen zu ungenau, um daraus Rückschlüsse ziehen zu können. Zudem sind singuläre Betrachtungen – sei es in Form eines Selbsttests oder eines Tests beim Arzt – nicht sinnvoll, da sich das Mikrobiom beispielsweise bereits durch ein Grillwochenende oder einen Urlaub verändern kann. Es müsste vielmehr im zeitlichen Verlauf analysiert werden.