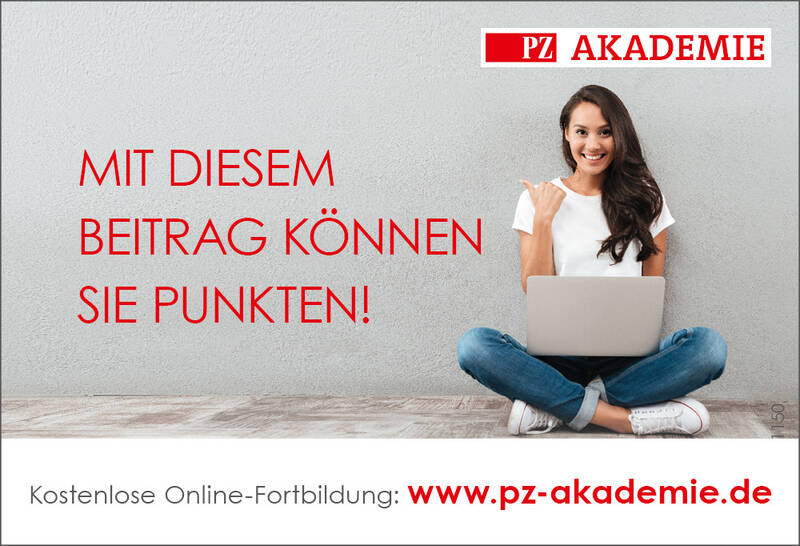Die hohe Lungentoxizität ist jedoch auch ein pharmakokinetisches Problem. Denn die Inaktivierung von Bleomycin erfolgt durch Deamidierung mittels einer Bleomycin-Hydrolase. Gerade dieses Enzym ist aber in der Lunge kaum vorhanden. Noch Jahre nach einer Therapie können als Spätfolge unter anderem Lungenfibrosen auftreten. Jährliche Vorsorgeuntersuchungen einschließlich Röntgenaufnahmen und Lungenfunktionstests sind daher dringend zu empfehlen (13).
Auch bei vielen anderen Zytostatika, beispielsweise Cisplatin, Cyclophosphamid, Busulfan, Carmustin oder Gemcitabin, sind Lungenschäden möglich. Risikofaktoren sind neben höherem Lebensalter vor allem die kumulative Medikamentendosis, eine zusätzliche Strahlentherapie, bestehende Lungenerkrankungen und hohe Sauerstoffgehalte in der Atemluft, beispielsweise beim Sporttauchen.