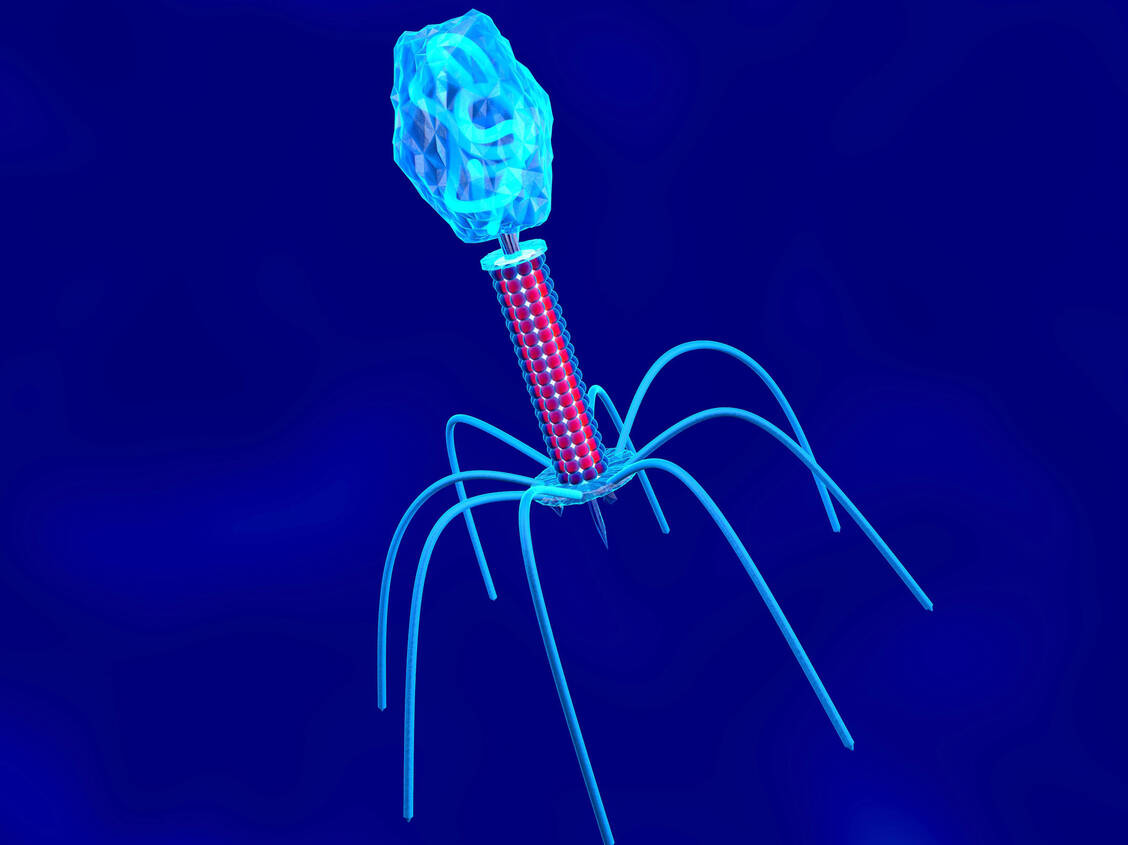Neben der Lactamase-Stabilität trägt der besondere Eintrittsmechanismus zur ausgezeichneten antibakteriellen Aktivität bei. Das Siderophor Cefiderocol nutzt mittels seiner Catecholstruktur, die dreiwertige Eisenatome komplexieren kann, einen Eisentransporter der Bakterien für die Penetration in die Zelle, zusätzlich zur passiven Penetration (19). Somit können Cefiderocol weder Mutationen der Porin-Kanäle, die β-Lactame ins Zellinnere transportieren, noch überexprimierte Effluxpumpen etwas anhaben. Die antimikrobielle Aktivität wird jedoch gemindert, wenn es zu Mutationen im Eisentransport-Protein kommt. Nichtsdestotrotz wurde eine Cefiderocol-Resistenz in KPC-produzierenden Klebsiellen mit erhöhten MHK-Werten beobachtet (20).