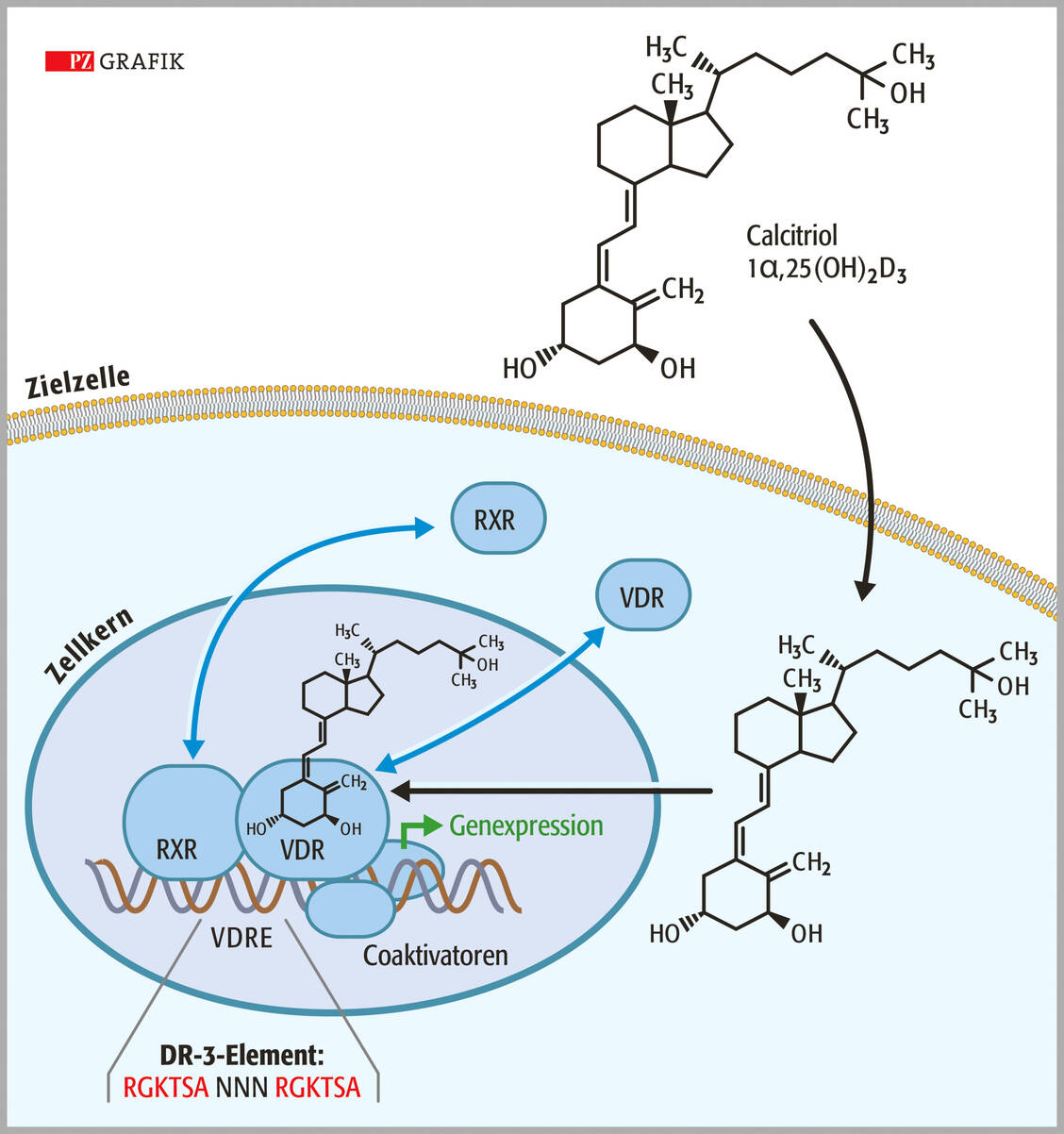Es wird vermutet, dass der Vitamin-D-Rezeptor mit weiteren Transkriptionsfaktoren interagiert, was die Heterogenität der Bindestellen und den pleiotropen, stark zelltypabhängigen Charakter vieler Vitamin-D-Effekte erklärt.
Interessant ist, dass in den vorliegenden genomweiten Datensätzen von unterschiedlichen Geweben und Zellen nur 54 der rund 20.000 Bindestellen in allen untersuchten Zellen beziehungsweise Geweben vorkommen. Die Daten weisen auf eine stark zellspezifische Funktion des VDR hin.
Die transkriptomweiten Analysen ergaben ferner, dass pro Zelltyp etwa 200 bis 600 primäre Vitamin-D-Responsgene existieren und dass die Gesamtzahl der Vitamin-D-regulierten Gene insgesamt deutlich über 1000 liegt (1). Die Daten legen nahe, dass die durch Vitamin D gesteuerten physiologischen Prozesse deutlich komplexer sind als bisher angenommen.