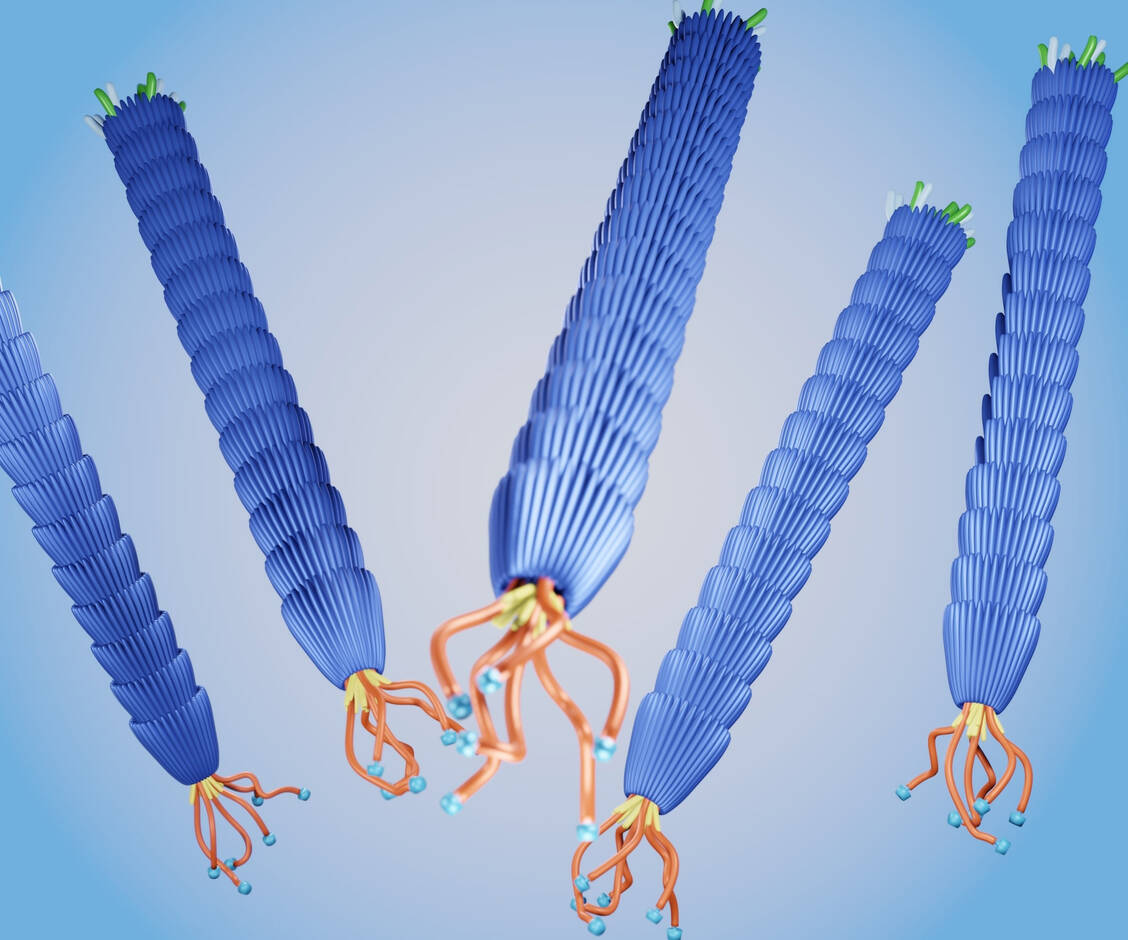Die Fortschritte in der Strukturaufklärung der letzten Jahrzehnte ermöglichen jetzt die rationale Entwicklung von Peptiden, die sich von Proteinsekundärstrukturen ableiten. Häufig handelt es sich um Inhibitoren sogenannter Protein-Protein-Interaktionen, beispielsweise die Tumorsuppressor-Interaktion von MDMX/p53 durch ALRN-6924 (in PhaseII). Hierbei werden Strukturelemente eines Proteins, zum Beispiel α-Helices, die maßgeblich an einer Protein-Interaktion zur Bildung des funktionellen Multiproteinkomplexes beteiligt sind, mittels synthetischer Peptide nachgeformt. Somit wird die Interaktion der beiden Proteine kompetitiv durch das Peptid gehemmt, was im Fall von MDMX/p53 zur Freisetzung des Tumorsuppressors p53 und somit zur Einleitung der Apoptose führt.