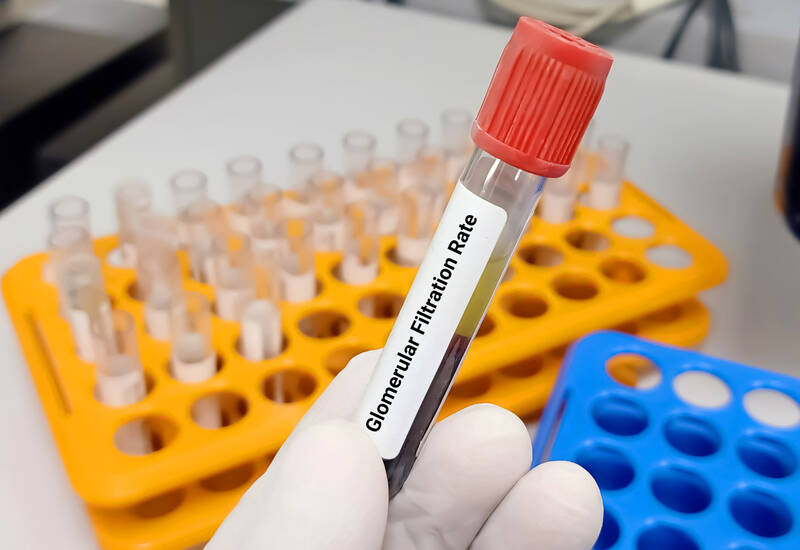Neu zugelassen wurde im April 2024 Aprocitentan (Jeraygo®) für die Behandlung des therapieresistenten Bluthochdrucks. Das Besondere an Aprocitentan ist sein neuartiger Wirkmechanismus. Die Blutdrucksenkung erfolgt über Behinderung der Bindung des Peptids Endothelin-1 (ET-1) an ETA- und ETB-Rezeptoren. ET-1 wird in verschiedenen Zellen und Geweben produziert (Endothelzellen, glatte Muskulatur, Makrophagen, renale Medulla) und führt nach Rezeptorbindung zu Vasokonstriktion, Fibrose, Zellproliferation, Inflammation und Aldosteron-Anstieg. Aprocitentan ist als Add-on-Therapie zugelassen, wenn eine Kombination von drei weiteren Blutdrucksenkern nicht zum gewünschten Zielblutdruck führt. Stand Juli 2024 ist noch kein Fertigpräparat in Deutschland auf dem Markt verfügbar.