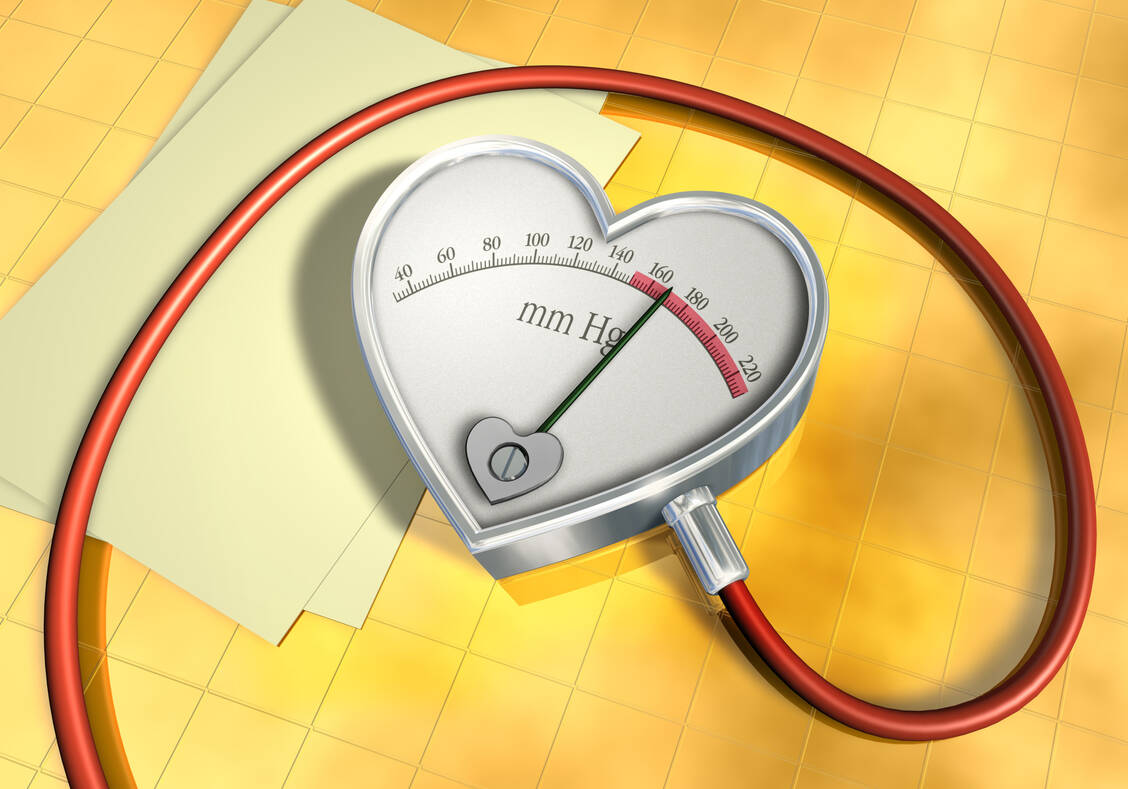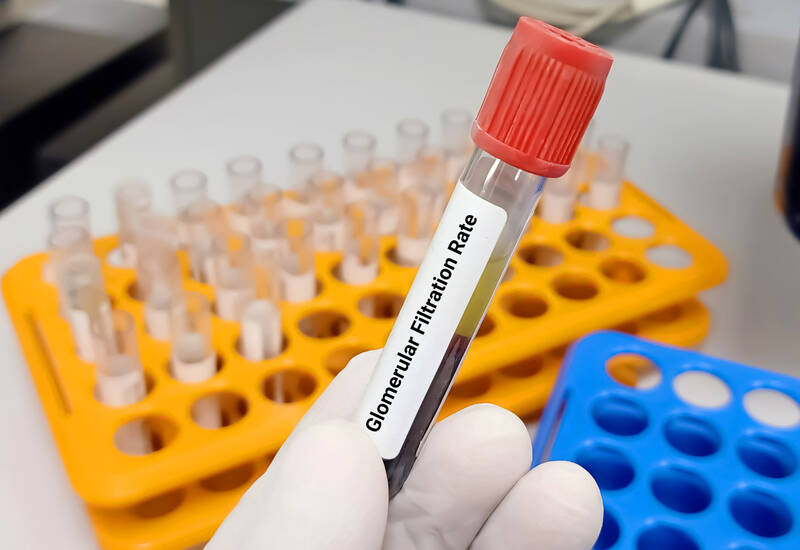Eine mangelnde oder fehlende Adhärenz hat nicht nur Auswirkungen auf die Einstellung des Blutdrucks, sondern ist mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko assoziiert (11). Adhärenzschulungen in der Apotheke, besonders wenn sie nach der Empfehlung der ESC/ESH-Leitlinie interprofessionell erfolgen, können hier einen wertvollen, wenn nicht überlebenswichtigen Beitrag leisten (12).
Zu den Risikofaktoren für eine schlechte Adhärenz zählen unter anderem ein sehr junges oder sehr hohes Patientenalter, schlechter sozioökonomischer Status, Erkrankungen mit geringer Symptomatik, das Auftreten von unerwünschten Arzneimittelwirkungen (UAW) und komplexe Therapieregime. Viele dieser Risikofaktoren sind bei der Therapie des hohen Blutdrucks zu finden. Die Adhärenz kann deutlich gesteigert werden durch: