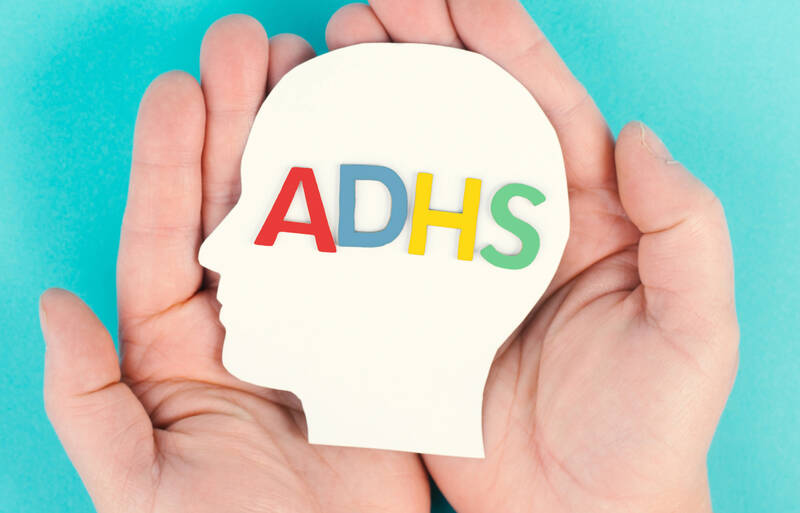ADHS galt lange als reine Kinderkrankheit, die sich auswächst. Doch inzwischen ist bekannt, dass mehr als 50 Prozent der Kinder und Jugendlichen mit der Entwicklungsstörung auch im Erwachsenenalter noch Symptome zeigen. Studien zufolge haben etwa 2,6 Prozent der erwachsenen Bevölkerung eine solche persistierende ADHS. »Doch die administrative Prävalenz, die etwa aus Krankenkassendaten ermittelt wird, fällt deutlich geringer aus«, berichtete Philipsen. So wurde etwa in einer AOK-Datenanalyse bei den 18- bis 65-Jährigen eine ADHS-Prävalenz von zuletzt 0,4 Prozent ermittelt. Auch laut Versichertendaten aus den USA liegt die Prävalenz unter 2 Prozent, was zeigt, dass es hier noch eine Diagnoselücke gibt.