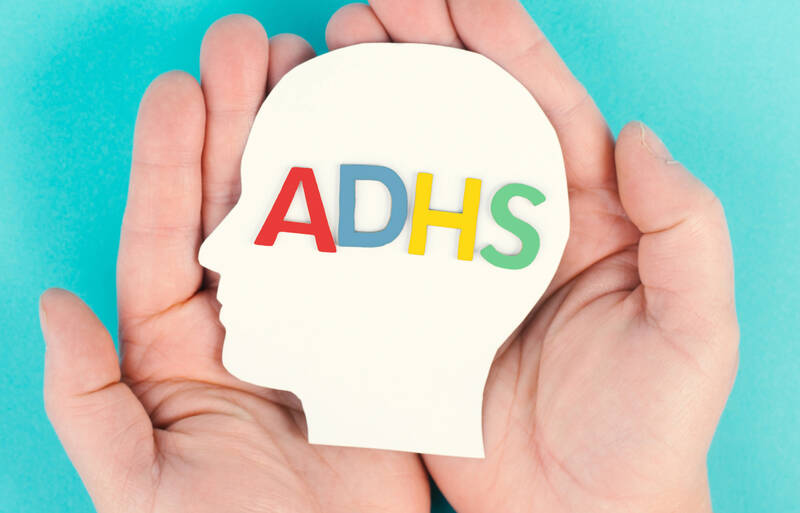Die bei der ADHS-Therapie eingesetzten Stimulanzien und Atomoxetin können mit einer Reihe von anderen Arzneistoffen wechselwirken. Stimulanzien wirken noradrenerg und dopaminerg. Aufgrund ihrer noradrenergen Wirkung können Methylphenidat und Lisdexamfetamin etwa zu Wechselwirkungen mit Antihypertensiva, Sympathomimetika, Sympatholytika und Antiglaukommitteln führen. So ist etwa die gleichzeitige Anwendung von Phenylephrin, Pseudoephedrin, Ephedrin und Ephedrakraut kontraindiziert. Auch Monoaminoxidase(MAO)-Hemmer sollten bei der Einnahme aufgrund des Risikos einer hypertensiven Krise gemieden werden. Das gilt auch für das Antibiotikum Linezolid. Eine Kombination der Stimulanzien mit anderen dopaminergen Substanzen wie Dopaminagonisten oder Levodopa kann das Risiko für Psychosen erhöhen. Stimulanzien können auch die Wirkung von Antipsychotika abschwächen und die Krampfschwelle senken, woraus sich eine Interaktion mit Antiepileptika ergibt. Bei Medikinet® adult und Medikinet® retard ist aufgrund ihrer Galenik Vorsicht bei der Kombination mit Protonenpumpeninhibitoren (PPI) geboten: Es besteht die Gefahr einer vorzeitigen Freisetzung von Methylphenidat.
Auch für das Nicht-Stimulanz Atomoxetin gilt, dass es nicht zusammen mit MAO-Hemmern angewendet werden darf. Die Therapie mit einem solchen Arzneistoff muss seit mindestens zwei Wochen beendet sein, bevor Atomoxetin angesetzt werden kann, und andersherum. Da Atomoxetin den Blutdruck anhebt, ist bei der gleichzeitigen Einnahme von Arzneimitteln, die diesen beeinflussen, Vorsicht geboten. Atomoxetin wird hauptsächlich über CYP2D6 verstoffwechselt, Inhibitoren des Enzyms können die Plasmaspiegel steigen lassen. Es besteht die Möglichkeit eines erhöhten Risikos für eine QT-Zeit-Verlängerung, wenn Atomoxetin zusammen mit anderen QT-Zeit-verlängernden Arzneistoffen eingenommen wird.