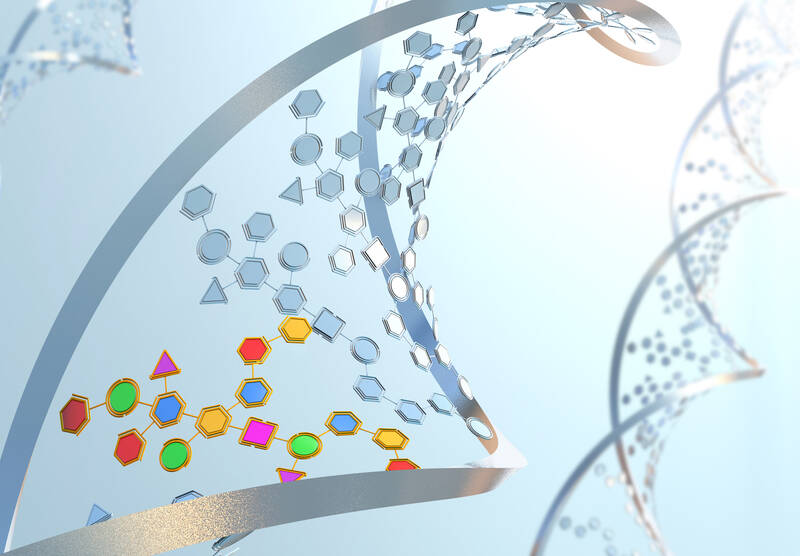Eine optimierte Krankheitseinstellung vor und während der gesamten Schwangerschaft ist auch bei Frauen mit Diabetes ganz entscheidend. Denn eine schlecht kontrollierte Stoffwechsellage mit häufigen Hypo- und/oder Hyperglykämien (insbesondere postprandial) führt nicht nur zu einer gegenüber nicht-diabetischen Frauen erhöhten Rate an Fehlbildungen, insbesondere Neuralrohrdefekten und Herzfehlern, sowie Spontanaborten (26). Sie birgt zudem ein erhöhtes Risiko für uteroplazentare Versorgungsprobleme, Harnwegs- und Scheideninfektionen, Hypertonie und Frühgeburten. Ein hohes Geburtsgewicht kann die Entbindung per Kaiserschnitt notwendig machen und sich langfristig auf die Gesundheit von Mutter und Kind auswirken: Die Wahrscheinlichkeit, dass im späteren Leben Übergewicht und/oder Diabetes auftreten, steigt deutlich.
Nach Möglichkeit sollte bereits vor, spätestens aber mit Eintritt der Schwangerschaft auf eine Therapie mit Humaninsulin umgestellt werden. Ist eine Patientin stabil auf kurzwirksame Insulinanaloga oder das Langzeitinsulin detemir eingestellt, so ist keine Umstellung erforderlich. Dagegen fehlen verlässliche Daten zu anderen Langzeitinsulinen sowie oralen Antidiabetika einschließlich Metformin (27). Optimal ist eine intensivierte Insulintherapie (ICT) oder eine Insulinpumpe (26).
Die hormonelle Umstellung während der Schwangerschaft kann die Einstellung eines konstanten Blutzuckerspiegels erschweren. Im ersten Trimenon besteht eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Insulin, weshalb insbesondere in der 8. bis 15. Schwangerschaftswoche verstärkt auf Hypoglykämien geachtet werden muss. Danach steigt der Insulinbedarf durch die dann auftretende Insulinresistenz stark an (um 50 bis 100 Prozent), fällt aber nach der Geburt schlagartig wieder ab (26). Die Frau sollte ihren Blutzuckerspiegel sehr häufig bestimmen (vor und nach den Mahlzeiten und sportlichen Aktivitäten, vor dem Schlafengehen und hin und wieder auch nachts) und die Insulindosis entsprechend anpassen. Eine engmaschige Kontrolle durch den Gynäkologen und den Diabetologen ist in jedem Fall empfehlenswert.