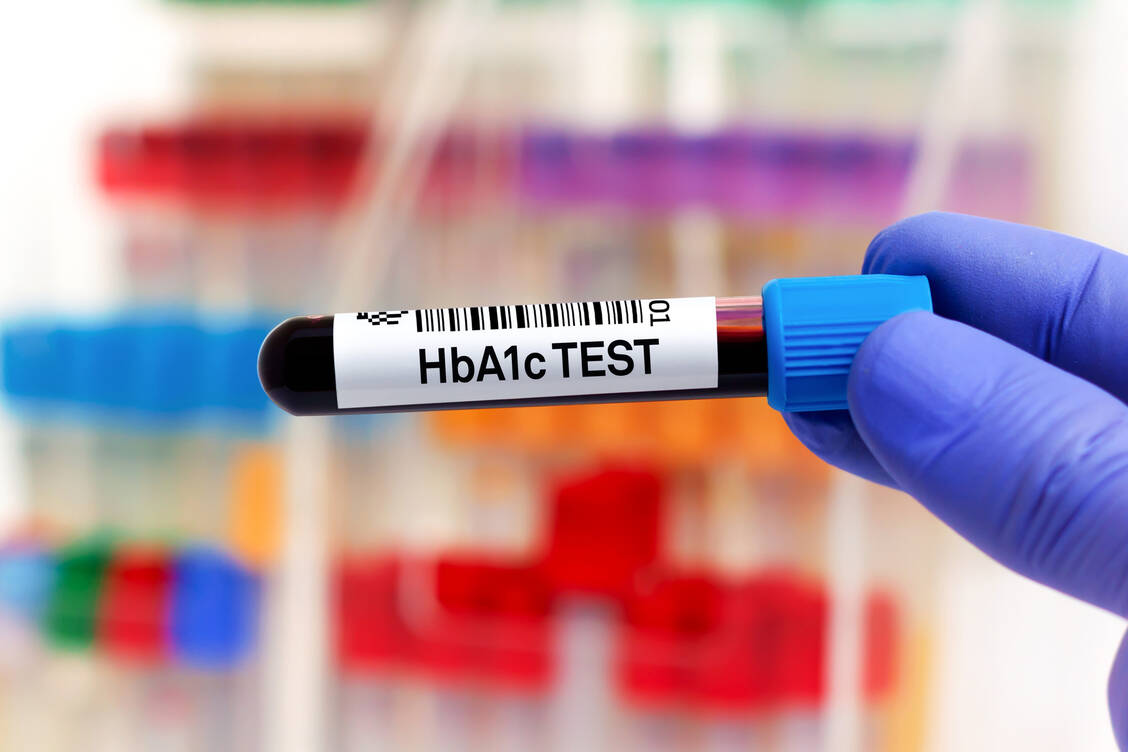Die 5047 teilnehmenden Typ-2-Diabetiker hatten zu Beginn der Studie HbA1c-Werte zwischen 6,8 und 8,5 Prozent; angestrebt werden Werte zwischen 6,5 und 7,5 Prozent. Als primärer Endpunkt war die kumulative Inzidenz eines HbA1c-Werts ≥ 7 Prozent während des median fünfjährigen Beobachtungszeitraums definiert. Hier zeigten sich signifikante Unterschiede: Der HbA1c-Wert überschritt unter Metformin plus Insulin glargin während 26,5 pro 100 Teilnehmerjahren die 7-Prozent-Marke; unter Metformin plus Liraglutid waren es mit 26,1 pro 100 Teilnehmerjahren annährend gleich viele. Dagegen lagen die entsprechenden Werte für Metformin/Glimepirid mit 30,4 pro 100 Teilnehmerjahren beziehungsweise Metformin/Sitagliptin mit 38,1 pro 100 Teilnehmerjahren höher. Der sekundäre Endpunkt, die Senkung des HbA1c-Werts unter 7,5 Prozent, bestätigte dieses Ergebnis.