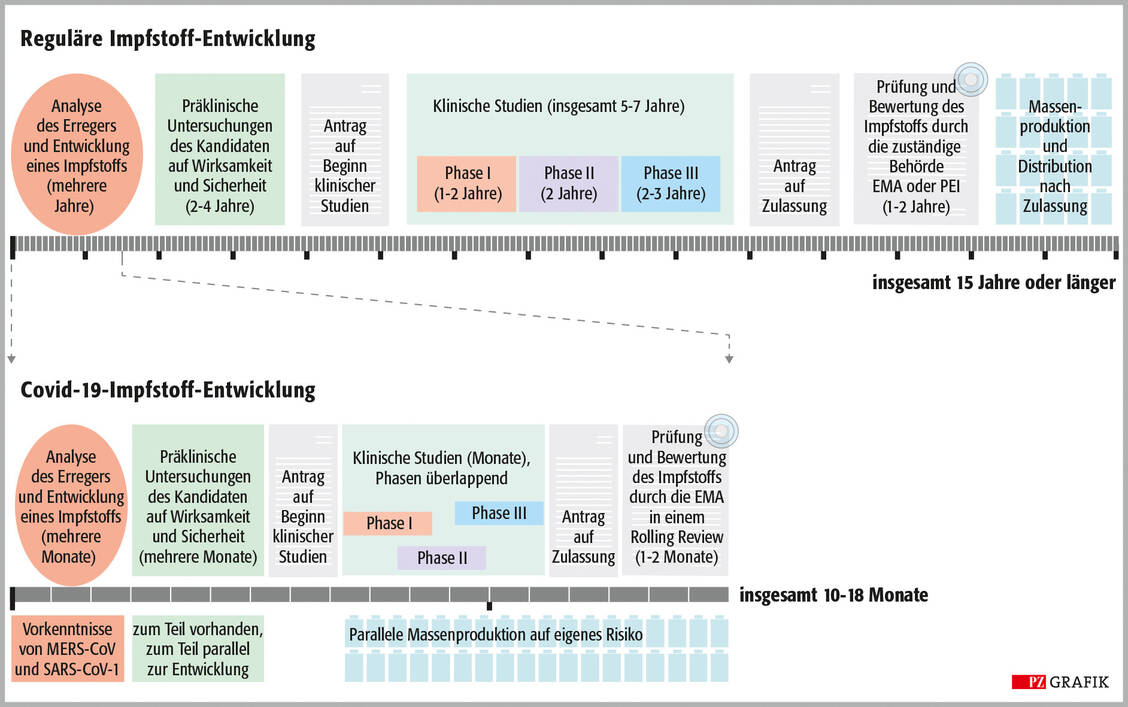Ein deutlich konservativerer Ansatz sind Protein-Impfstoffe. Sie enthalten gentechnisch hergestelltes S-Protein, analog zum Hepatitis-B-Impfstoff, der Hepatitis-B-Oberflächenantigen enthält, oder zum HPV-Impfstoff, der als Antigen L1-Proteine verschiedener Typen des humanen Papillomavirus beinhaltet. Ein SARS-CoV-2-Impfstoff nach diesem Prinzip befindet sich bereits in Phase III der klinischen Entwicklung, nämlich der Kandidat des US-Unternehmens Novavax, der mit Matrix-M1 adjuvantiert ist. In Phase I/II befindet sich die Protein-Vakzine des Konsortiums Sanofi/Glaxo-Smith-Kline (GSK). Eine Phase-III-Studie soll noch in diesem Jahr beginnen.
Aktuell startet in Deutschland auch eine klinische Phase-I-Studie mit einem adjuvantierten Peptid-Impfstoff, der an der Universität Tübingen entwickelt wurde. Antigene sind bei ihm Bruchstücke (Peptide) von mehreren SARS-CoV-2-Proteinen, darunter das S- und das Nukleokapsid-Protein.