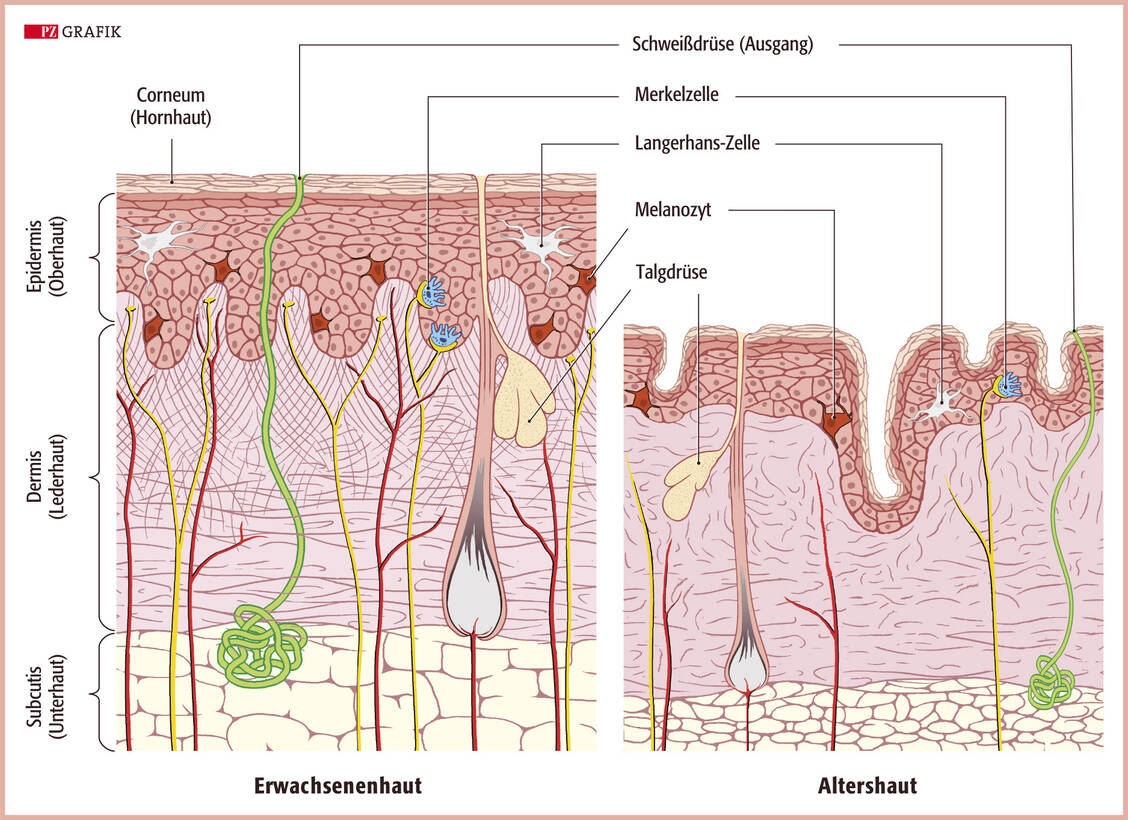Endogene und exogene Faktoren beeinflussen den Hautzustand. Auch Systemerkrankungen hinterlassen Spuren. Der hohe Blutglucosewert bei Diabetes mellitus schädigt Zellstrukturen. Die Haut wird sehr empfindlich, neigt zu Trockenheit, Pigmentstörungen, erhöhter Infektanfälligkeit und gestörter Wundheilung. Der angekurbelte Stoffwechsel einer Hyperthyreose fördert Durchblutung, Schweiß- und Talgproduktion. Die Hypothyreose zeigt sich dagegen mit Trockenheit und Juckreiz. Bei Störungen des Lipidstoffwechsels lagert sich Fett (Xanthome) unter der Haut ab. Lebererkrankungen färben die Haut gelblich oder hinterlassen Leberhautzeichen, spinnenartige, stecknadelkopfgroße Knötchen. Ist die Niere erkrankt, wird die Haut fahl und trocken.