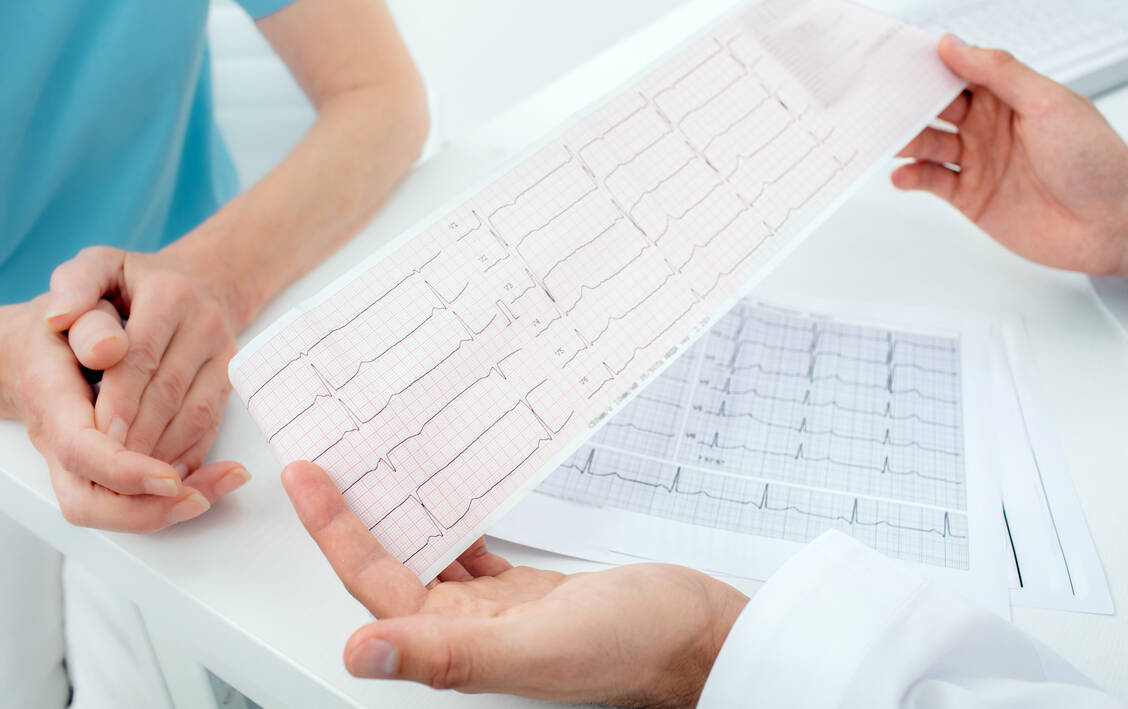Verschiedene Organisationen bieten Betroffenen und ihren Bezugspersonen Informationen und Unterstützung an.
Die Lebenshilfe bietet Unterstützung und Informationen für Menschen mit Down-Syndrom, ihre Familien und Angehörigen und informiert in einfacher Sprache über Trisomie 21. Darüber hinaus organisiert die Lebenshilfe Seminare für Eltern und Angehörige und gibt Hilfestellungen, um den Umgang mit schwierigen Verhaltensweisen wie Wutausbrüchen zu erleichtern. Sie verleiht regelmäßig den Medienpreis »Bobby«.
Das Down-Syndrom-Netzwerk vermittelt Hintergründe und Wissenswertes.
Der Arbeitskreis Down-Syndrom setzt sich aktiv für die Rechte von Menschen mit Down-Syndrom ein und informiert in leichter Sprache über relevante Themen. Es gibt Angebote für persönliche Beratung und Infomaterialien.
Das Magazin »Ohren-Kuss« präsentiert Texte von Menschen mit Down-Syndrom. Sie schreiben zu Themen, die ihnen am Herzen liegen.
TOUCHDOWN 21 ist ein Forschungsprojekt mit dem Ziel, mehr über das Leben, die Wünsche und die Fähigkeiten von Menschen mit Down-Syndrom herauszufinden und dieses Wissen weiterzugeben. Es wird von einem Team geleitet, das aus Menschen mit und ohne Down-Syndrom besteht. Neben der Forschung bietet TOUCHDOWN 21 auch Vorträge, Workshops und Ausstellungen an, um die Gesellschaft zu informieren und Vorurteile abzubauen.
Das Deutsche Down-Syndrom InfoCenter bietet umfassende Informationen, Beratung und Materialien für Menschen mit Down-Syndrom, ihre Familien und Fachleute und gibt die Fachzeitschrift »Leben mit Down-Syndrom« heraus.