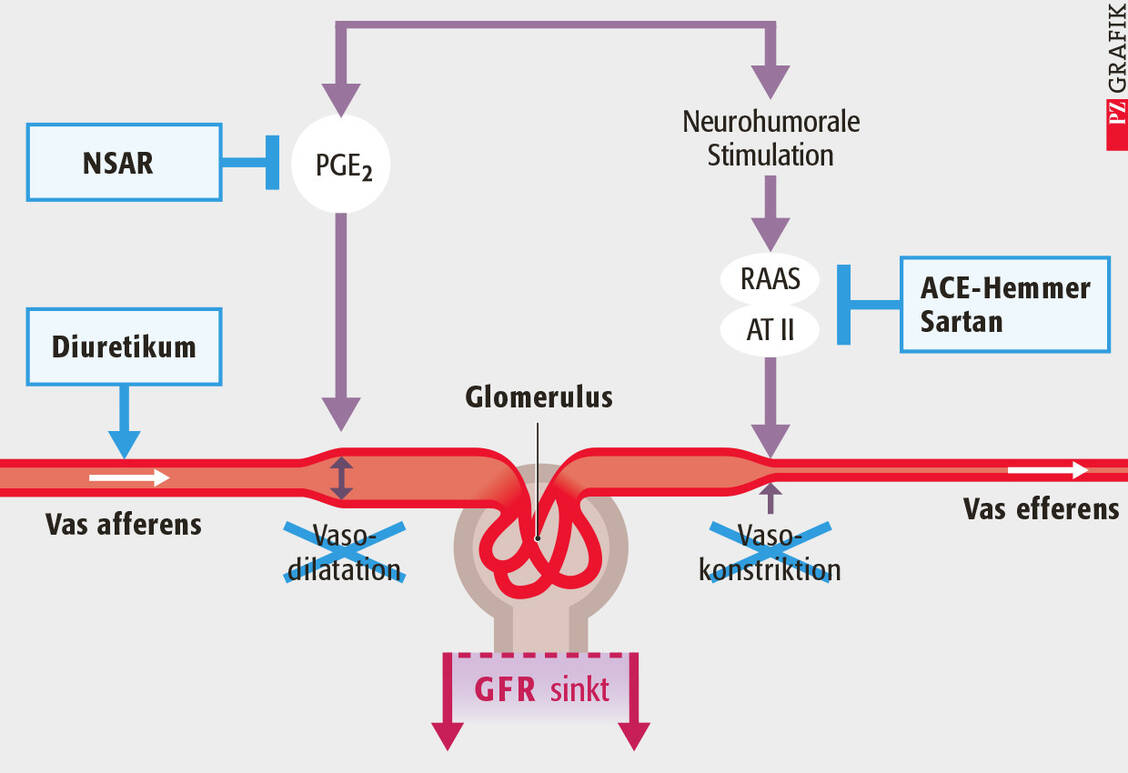|
Substanz
|
übliche Indikation und/oder Wirkung
|
Nephrotoxische Effekte
|
|
Artemisia absinthium (Wermutkraut, Bitterer Beifuß)
|
AnämieAsthmagastrointestinale Störungenantipyretisch, appetitsteigernd
|
Rhabdomyolyse mit akuter intratubulärer Obstruktion und evtl. tonisch-klonischen Krämpfen
|
|
Chromium
|
BlutzuckerkontrolleGewichtsabnahmefettsenkend
|
akute TubulusnekroseInterstitielle Nephritis
|
|
Ephedra (Meerträubel, Ma-Huang)
|
allergische RhinitisAsthmaHypotensionsexuelle StimulationGewichtsabnahme
|
Nephrolithiasis aufgrund Ephedrin-, Norephedrin- und Pseudoephedrin-Steinbildung
|
|
Germanium
|
antiinflammatorischimmunstimulierend
|
tubuläre Degenerationgeringe glomeruläre Schädigung
|
|
Glycyrrhiza glabra (Süßholz, Lakritze)
|
gastrointestinale Störungenantibiotischantiinflammatorischdiuretisch
|
renal tubulärer Schaden aufgrund prolongierter Hypokaliämiehypokaliämische Rhabdomyolyse bei Pseudohyperaldosteronismus
|
|
Kreatin
|
verbesserte Muskelleistung bei intensivem Krafttraining
|
akute fokale interstitielle Nephritis und fokale Tubuluszellnekroseunspezifische NierenschädigungRhabdomyolyse
|
|
Hedeoma pulegioides (Frauenminze)
|
Abort induzierendmenstruationsfördernd
|
ödematöse hämorrhagische Nieren mit akutem Tubulusschaden und hepatorenalem Syndrom
|
|
Hydrazin
|
Anorexie, Kachexiechemotherapeutisch
|
bei durch Hydrazin induziertem hepatorenalen Syndrom: Autolyse der Nieren möglich
|
|
Vaccinium macrocarpon (Cranberry)
|
Urinansäuerungantibiotisch
|
Nephrolithiasis aufgrund von Oxalurie
|
|
Larrea tridentata (Kreosotbusch, Chaparral)
|
antiinflammatorischantibiotisch, antioxidativ
|
zystische NierenerkrankungNierenzellkarzinom
|
|
L-Lysin
|
antiviralwundheilungsfördernd
|
Fanconi-Syndrom und interstitielle Nephritis
|
|
Salix daphnoides (Reifweide, enthält Salicin)
|
analgetischantiinflammatorisch
|
nekrotische Papillen wie bei Analgetika-Nephropathie
|
|
Thevetia peruviana (Schellenbaum, tropischer Oleander)
|
antiinflammatorisch
|
Tubuluszellnekrose mit Vakuolen, evtl. hepatorenales Syndrom
|
|
Tripterygium wilfordii (Celastraceae, »Thunder god vine«)
|
immunsuppressiv bei Rheuma
|
Schock und akutes Nierenversagen
|
|
Vitamin C
|
Verstärkung der EisenresorptionSchutz vor Krebs und koronarer Herzkrankheitwundheilungsfördernd
|
Nephrolithiasis aufgrund von Oxalurie
|
|
Yohimbe (Pausinystalia yohimbe, »Liebesbaum«)
|
erektile Dysfunktionsexuelle Stimulation
|
systemischer Lupus erythematodes, Lupusnephritis
|