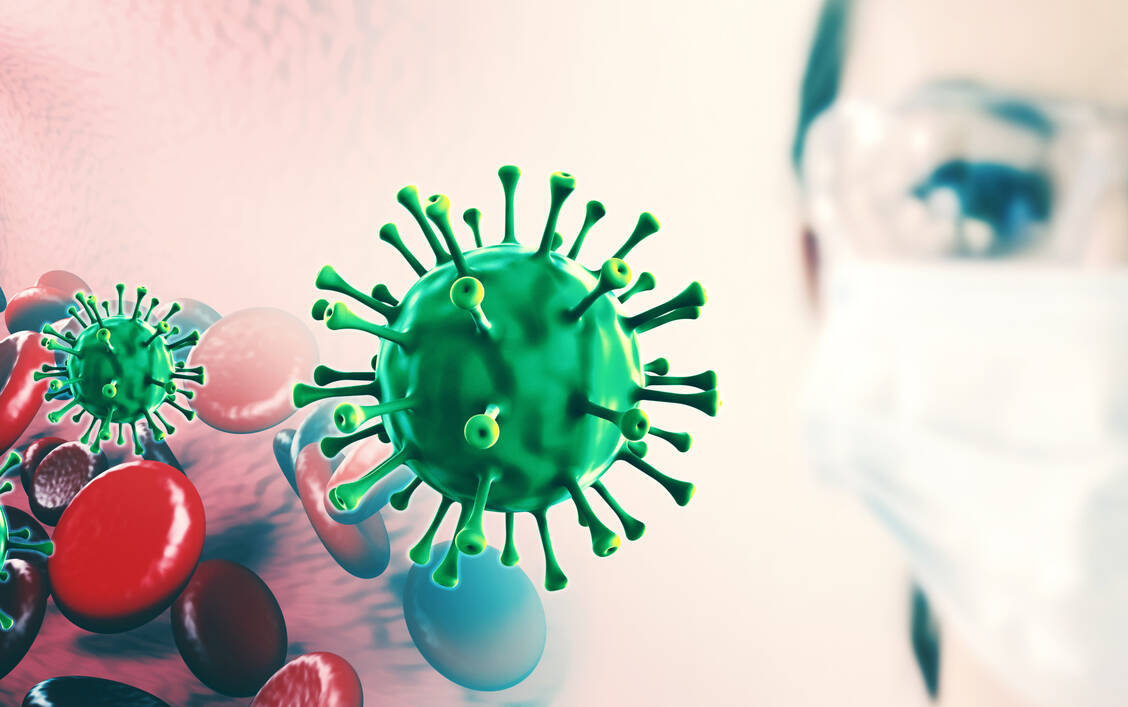Viele bekannte und für andere Indikationen zugelassene Wirkstoffe werden auf ihre Eignung bei Covid-19 getestet (Repurposing). In zahlreichen Projekten werden aber auch ganz neue, noch nicht zugelassene Wirkstoffe untersucht. Der Verband Forschender Arzneimittelhersteller (VFA) listet Arzneistoffe aus dieser Kategorie auf, die die Phase II/III der klinischen Testung erreicht haben. Einige davon könnten bereits 2021 eine Zulassung bei Covid-19 erhalten.
Der gegen das Spike-Protein von SARS-CoV-2 gerichtete Antikörper Bamlanivimab könnte dazu zählen, ebenso das Antikörper-Duo Casirivimab und Imdevimab, das in einem Präparat enthalten ist und ebenfalls auf das Spike-Protein des Coronavirus abzielt. Eine Kombination aus zwei Antikörpern stellt auch AZD7442 dar. Weitere antivirale Antikörper sind VIR-7831 und TY027.
Molnupiravir wurde ursprünglich als Grippemedikament entwickelt, könnte nun aber zum Covid-19-Medikament umschulen. Der Wirkmechanismus des RNA-Polymerase-Hemmers erinnert an das zugelassene Remdesivir. Jedoch muss Molnupiravir nicht infundiert werden, sondern ist oral bioverfügbar. Es wird in Studien mit ambulant behandelten Patienten geprüft.
Immundämpfend wirkt der Antikörper Vilobelimab (IFX-1), der ins Komplementsystem, einen Teil des angeborenen Immunsystems, eingreift. Vilobelimab richtet sich gegen die Komplementkomponente C5a und wird derzeit in einer Phase-III-Studie mit intubierten Patienten geprüft.
Ifenprodil, ein Inhibitor am NMDA-Rezeptor, wird in Phase II/III untersucht. Die Aktivierung von T-Zellen über Glutamat kann deren Proliferation und die Freisetzung von Zytokinen verursachen. Ifenprodil soll diese Prozesse blockieren und eine überschießende Immunreaktion bremsen.
Eigentlich als Krebsmedikament gedacht ist der Wirkstoff Opaganib. Er wirkt als selektiver Sphingosinkinase-2-Inhibitor und blockiert dadurch die Synthese von Sphingosin-1-Phosphat. Dieses Lipid-Signalmolekül fördert das Krebswachstum, aber auch pathologische Entzündungen. Die Rationale, Opaganib auch bei Covid-19-Patienten einzusetzen, beruht neben der antientzündlichen Komponente auf den antiviralen Eigenschaften des Wirkstoffs. Mehr zu neuen Ansätzen gegen Covid-19 lesen Sie im Titelbeitrag in PZ 45/2020.