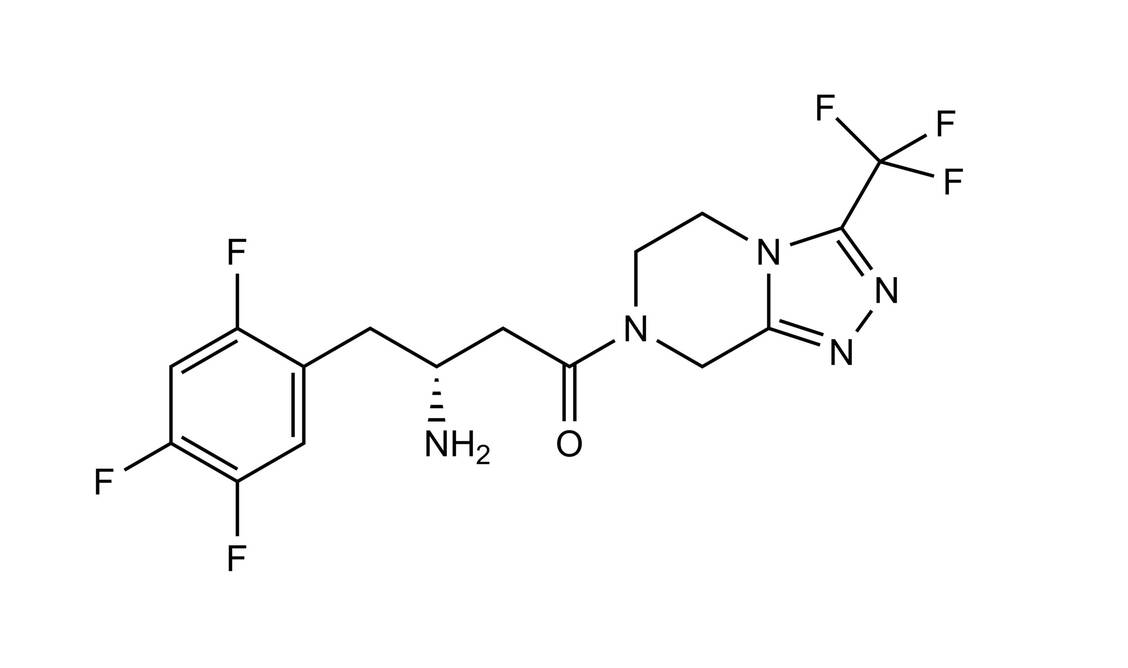Sitagliptin ist ein Dipeptidylpeptidase-4-Hemmer (DPP-4-Hemmer). Der Wirkstoff steigert die Aktivität von Darmhormonen, indem er ihren Abbau bremst. Das Glucagon-like Peptide-1 (GLP-1) gehört ebenso zu dieser Gruppe der Inkretinhormone wie das Glucose-dependent-Insulinotropic-Peptide (GIP). Nach der Aufnahme von Kohlenhydraten sezernieren Zellen im Darm GLP-1 und GIP. Als Folge steigt die Insulinsekretion. Das geschieht allerdings nur unter hyperglykämischen Bedingungen. Bei Normo- oder Hypoglykämie erhöhen die Peptide die Insulinsekretion nicht. Dieser sogenannte Inkretineffekt ist bei Menschen mit Typ-2-Diabetes vermindert.
GLP-1 hat vielfältige weitere Effekte. Es hemmt die Glucagonfreisetzung, die bei Typ-2-Diabetikern oft erhöht ist. In der Folge sinkt die hepatische Glucoseproduktion. Zudem verzögert es die Magenentleerung und drosselt den Appetit. Endogenes GLP-1 weist eine sehr kurze Halbwertszeit auf, da es durch das Enzym DPP-4 zu unwirksamen Metaboliten abgebaut wird. Wird DPP-4 durch Sitagliptin oder ein anderes Gliptin gehemmt, bleiben GLP-1, GIP und andere Substrate des Enzyms länger aktiv.