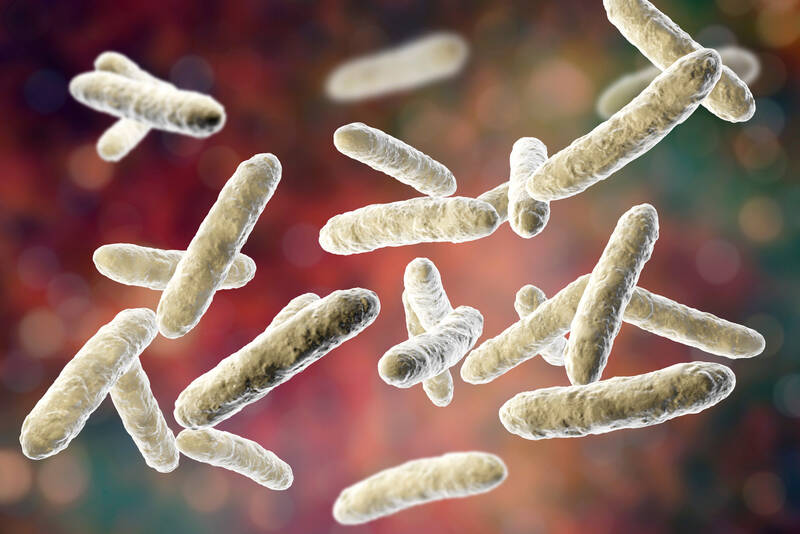Eine chronische Schleimhautentzündung betrifft nicht nur den Magen-Darm-Trakt, sondern kann auch bei Rhinosinusitis zum Problem werden. Für beide Lokalisationen gibt es Hinweise auf einen Zusammenhang mit dem Mikrobiom. So ergaben Untersuchungen im Atemtrakt Unterschiede im Mikrobiom von Gesunden und Patienten mit nasopharyngealen, tracheobronchialen und pulmonalen Erkrankungen. Gesunde hatten eine hohe Vielfalt an Bakterienkolonien, die jeweils in geringer Dichte auftraten. Bei Infektionen, Asthma, chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) oder Mukoviszidose nahm die Vielfalt ab und Kolonien einzelner Arten überwogen (12).
Dabei wurde in den oberen Atemwegen bei Gesunden häufig Lactobacillus nachgewiesen, insbesondere der an die Umgebung der oberen Atemwege gut adaptierte Typ Lactobacillus casei AMBR2. Bei Patienten mit chronischer Rhinosinusitis fanden die Forscher dagegen verschiedene Lactobacillus-Stämme (Lactobacillus genus complex, LGC) jeweils nur in geringeren Mengen (13). Darüber hinaus konnten sie zeigen, dass die Zytokinantwort des Immunsystems bei Infektion mit gängigen Atemwegserregern wie Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae und Moraxella catarrhalis besser war, wenn das Mikrobiom auch Lactobacillus casei AMNR8 enthielt.
Folglich wird diskutiert, ob der Einsatz von Lactobazillen in»probiotischen Nasensprays« das Überwachsen der Nasenschleimhaut mit pathogenen Erregern eindämmen könnte (13).