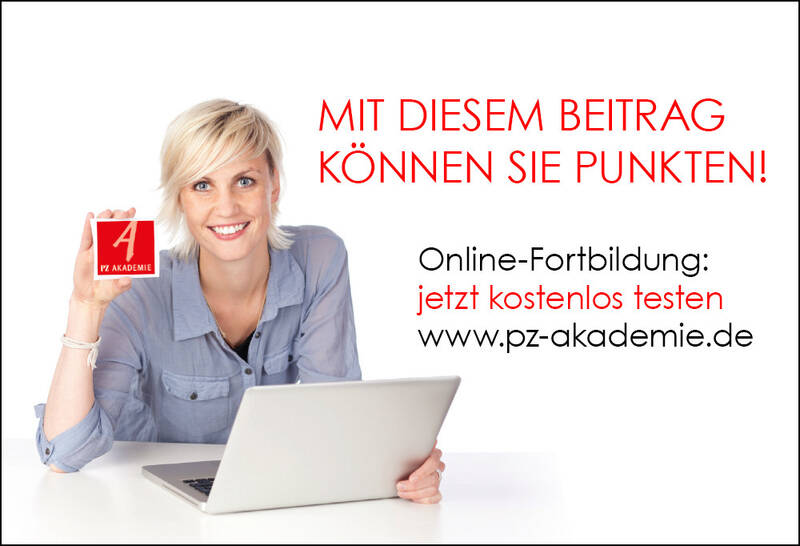Bei der Medikationsanalyse für eine Asthma-Patientin fällt dem Apotheker auf, dass die Frau Beclomethason als Dosieraerosol vom Hausarzt und Fluticason als Diskus vom Facharzt verordnet bekommen hat. Weiterhin hat sie noch ein Salbutamol-Dosieraerosol für den Bedarfsfall. Sie gibt an, beide Corticoid-haltigen Arzneimittel jeweils zweimal täglich zu inhalieren. Der Apotheker stellt fest, dass beide Ärzte nichts von der Verschreibung des anderen Kollegen wissen und hier eine Pseudo-Doppelmedikation vorliegt (Verordnung von zwei nicht identischen Wirkstoffen aus der gleichen Gruppe).
Der Apotheker informiert den Hausarzt mit einem kurzen Fax: »Unsere Patientin X inhaliert sowohl zweimal täglich mit dem Fluticason-Diskus als auch mit dem Beclomethason-Dosieraerosol, das von Facharzt Dr. Z verordnet wurde. Könnte es sich um eine versehentliche Pseudo-Doppelmedikation handeln? Nach Überprüfung der Inhalationstechnik rate ich zur weiteren Anwendung des Pulverinhalators, da hiermit die Inhalation am besten umgesetzt werden kann.« Die Apotheke erhält kurze Zeit später ein kurzes Antwortfax vom Arzt: »Vielen Dank für die Information! Patientin bitte zur Überprüfung in die Praxis schicken.«
Beim nächsten Besuch in der Apotheke berichtet die Patientin, dass das Dosieraerosol abgesetzt wurde und sie die Anwendung des Pulverinhalators fortsetzen soll.