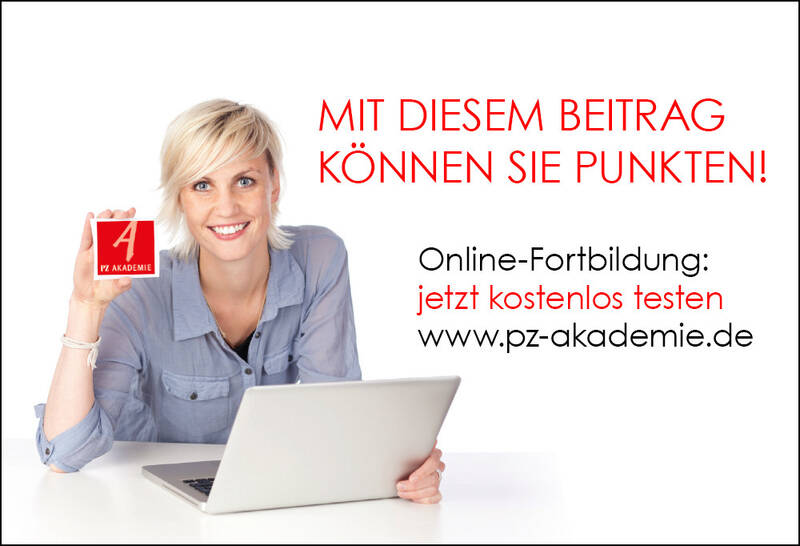Ein älterer Patient löst eine Reihe von Rezepten ein. Er leidet an Typ-2-Diabetes und Herzinsuffizienz und nimmt mehrere Antidiabetika und Antihypertonika ein. Abends spritzt er seit einigen Monaten einige Einheiten Insulin glargin.
Die Apothekerin fragt ihn, wie er mit dem Injizieren zurechtkommt. Sie sieht in der Kundenhistorie, dass bisher nur einmal Nadeln in der Apotheke geholt wurden. Deshalb fragt sie den Patienten, ob er die Nadeln jeden Tag wechselt und immer eine andere Hautfalte für die Injektion auswählt. Es stellt sich heraus, dass der Patient sehr sparsam ist und höchstens einmal pro Woche die Nadel wechselt. Die Apothekerin demonstriert mit einem Übungspen, wie die Nadel ausgetauscht und die Dosierung eingestellt wird. Sie zeigt eine mikroskopische Abbildung einer vielfach benutzten Nadel, um die Bedeutung des regelmäßigen Nadelwechsels zu veranschaulichen.
Um die Adhärenz des Patienten zu überprüfen, fragt die Apothekerin: »Vergessen Sie schon einmal, eines Ihrer Medikamente einzunehmen? Und wenn ja, wie oft?« Der Mann räumt ein, dass er die Ramipril-Tabletten am Morgen ab und zu weglässt. Auf Nachfrage antwortet er, dass ihm immer mal schwindelig sei und er das auf die Tabletten zurückführe. Deshalb nehme er diese Blutdrucktabletten nur zwei- bis dreimal pro Woche. Der Arzt wisse das aber nicht.
Die Apothekerin schlägt vor, regelmäßig den Blutdruck zu messen, um festzustellen, ob die Werte tatsächlich zu niedrig sind. Sie erläutert, dass die Medikamente den hohen Blutdruck nicht heilen, sondern nur kontrollieren, solange sie regelmäßig eingenommen werden. Dies schütze Herz und Gefäße. Ihr Vorschlag: »Könnten wir vereinbaren, dass Sie zwei Wochen lang alle Ihre Medikamente genauso einnehmen, wie es der Arzt verordnet hat, und Sie in dieser Zeit täglich den Blutdruck überprüfen und die gemessenen Werte aufschreiben? Dann besprechen Sie die Werte und die Medikamente einmal mit dem Hausarzt. Er kann dann entscheiden, ob Sie möglicherweise mit einer geringeren Dosis auskommen. Was halten Sie davon?«
Der Patient stimmt zu. »Ja, das ist eine gute Idee. Das wusste ich alles nicht. Wie gut, dass Sie mir das erklärt haben.«