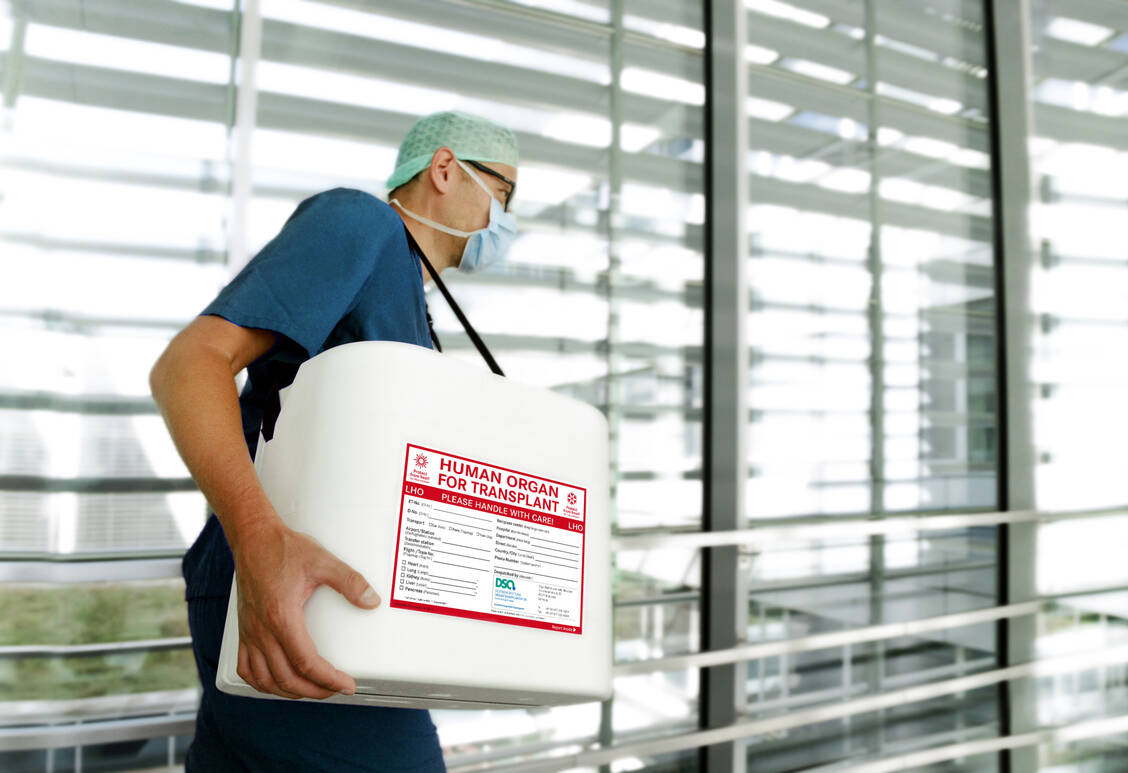Eine vollständige Heilung würde voraussetzen, dass die integrierte DNA entfernt oder zumindest dauerhaft stillgelegt werden kann. Davon ist die Forschung zurzeit noch weit entfernt. Das übergeordnete Ziel lautet daher, nicht mehr nur das Virus zu kontrollieren, sondern die »funktionelle Heilung« voranzutreiben. Eine funktionelle Heilung ist durch eine dauerhafte Immunkontrolle und den Verlust des HBsAg charakterisiert. Neue potenzielle Wirkstoffkandidaten greifen an verschiedenen Punkten der Virusvermehrung und hier an neuen Targets an.
Über Bindung an den NTCP-Rezeptor (NTCP: Natrium-taurocholate cotransporting polypeptide) heftet sich das Virus an die Wirtszelle an und tritt anschließend durch Endozytose in die Leberzelle ein. Sogenannte Entry-Inhibitoren greifen in diesen Prozess ein und können so die Infektion von noch uninfizierten Hepatozyten verhindern. Ein Vertreter dieser Klasse ist Myrcludex B (Bulevirtid). Das synthetische Peptid konkurriert am NTCP-Rezeptor mit dem Virion um die Aufnahme in die Leberzelle. Als Virionen werden infektiöse Virusteilchen außerhalb der Wirtszelle bezeichnet. In klinischen Studien sowohl bei HBV- als auch Hepatitis-D-Virus-(HDV)-Infektionen war Bulevirtid wirksam gegen beide Virustypen.