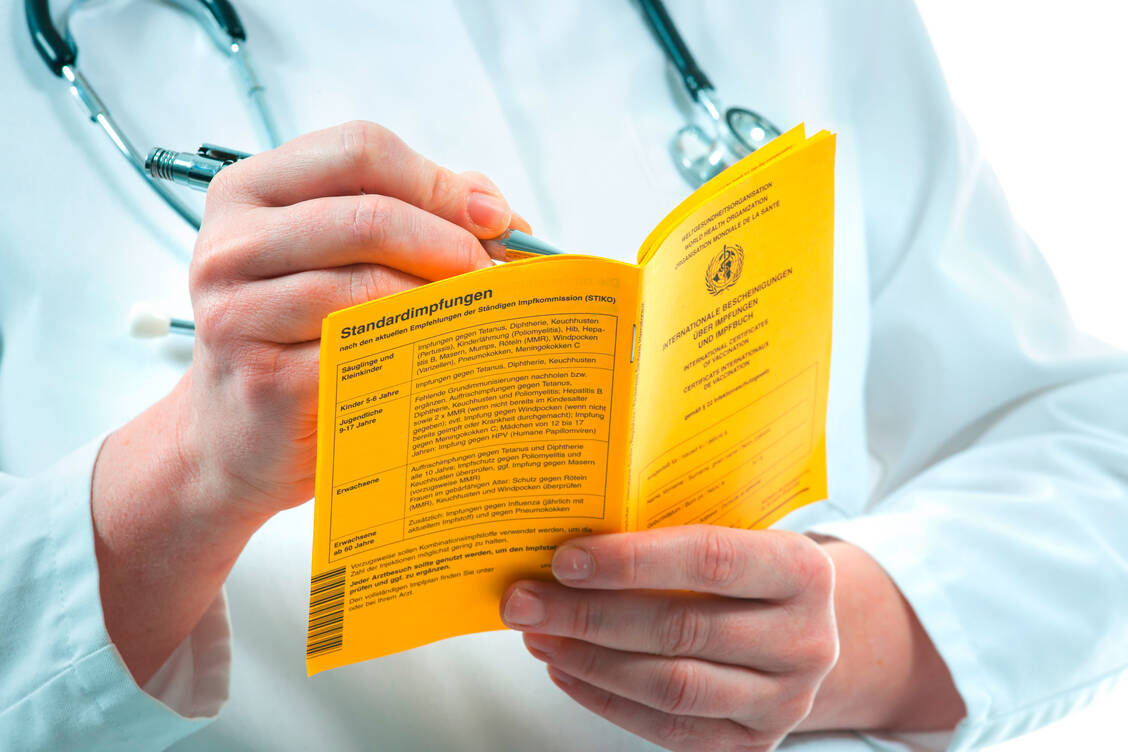Als »Virenschutzschild« und Möglichkeit, die Bläschen diskret abzudecken und die feuchte Wundheilung zu fördern, stehen in der Selbstmedikation auch »Herpesbläschen-Patches« zur Verfügung.
Die kleinen, fast unsichtbaren Pflaster besitzen eine Hydrokolloidschicht, die eine rasche Abheilung herbeiführen soll. Zudem wird von Anwendern eine Linderung von Schmerzen und Juckreiz beschrieben. Die Pflaster sollen auf dem Bläschen verbleiben, bis sie von allein abfallen, um die frisch gebildete, oberflächliche Haut nicht zu verletzen und die Wundheilung nicht zu stören. Sie können überschminkt werden (6).
Es zählt zu den gängigen Mythen, dass das Auftragen von Zahnpasta, Milch oder einer Mischung aus Lakritz und Vaseline zur Linderung von Herpes labialis beitragen könnte. Davon sollte dringend Abstand genommen werden, da die Wunde bis hin zu Entzündungen gereizt und die Wundheilung gestört werden kann. Gleiches gilt für die Behandlung mit Honig, Johanniskrautöl oder reinem Alkohol. Auch davon ist abzuraten, zumal insbesondere Letzteres auch sehr schmerzhaft sein kann.