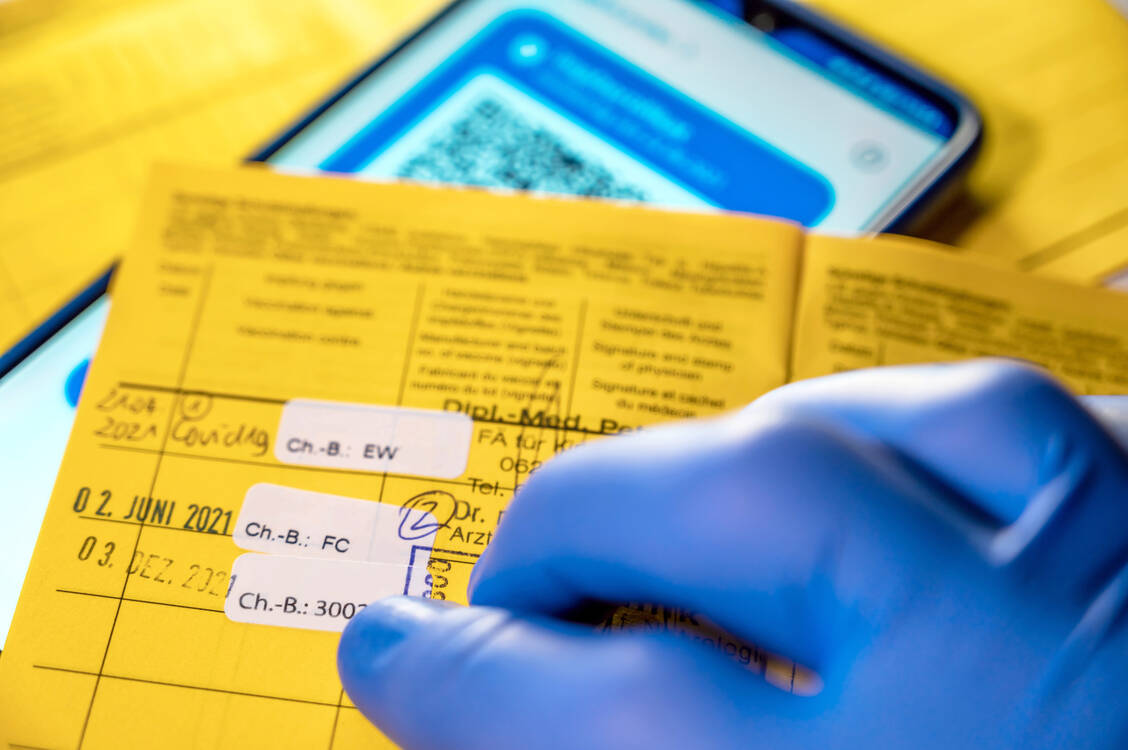Auch die Verhütungsmethode sollte bei transplantierten Frauen hinterfragt werden. Am sichersten sind Kondome und die Verwendung von Spermiziden, da die Wirkung der Pille durch die Immunsuppressiva abgeschwächt sein kann.
Neben allgemeinen Beschwerden gibt es organspezifische Abstoßungssymptome: Sobald ein Lebertransplantat abgestoßen wird, kann es zu einer Gelbfärbung von Augen und Haut kommen. Bei Patienten nach einer Herztransplantation können Herzrhythmusstörungen vorkommen und nach einer Lungentransplantation ist Luftnot ein Alarmsymptom.
Auch zur Prävention kardiovaskulärer Komplikationen sowohl medikamentös (Einnahme von CSE-Hemmer, Thrombozytenaggregationshemmer, Blutdruckmanagement) als auch durch Verhaltensanpassungen (regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung, Verzicht auf Rauchen) kann das Apothekenteam unterstützend beraten.