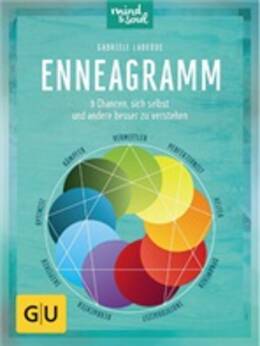Starke Opioide schnitten mit 12,0 Punkten zwar auf den ersten Blick am besten ab und lagen vor schwachen Opioiden (10,6) und anderen Schmerzmitteln (8,4), Psychotherapie (5,5) und Physiotherapie (4,5). Doch waren diese Unterschiede statistisch nicht signifikant, wie sich anhand der 95-Prozent-Konfidenzintervalle herausstellte. »Die Ergebnisse unserer Analyse haben uns selbst erstaunt, denn es zeigte sich, dass langfristig gesehen die schmerzlindernden Wirkungen von medikamentösen Therapieverfahren klinisch unbedeutend sind, im Vergleich zu einem Placebo«, sagte Professor Dr. Christoph Stein, einer der Autoren und Schmerzmediziner an der Berliner Charité, in einer Pressemitteilung.
Starke Opioide wie Morphin sind die dritte Stufe des von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelten Stufenschemas zur Schmerztherapie. Darin stellen Nicht-Opioid-Analgetika wie Paracetamol und Ibuprofen die erste, schwache Opioide wie Dihydrocodein, Tramadol und Tilidin die zweite Stufe dar. Das Schema wurde von der WHO ursprünglich zur Therapie von Tumorschmerzen entwickelt, doch findet es auch in der Behandlung chronischer Schmerzen anderer Genese Anwendung. /