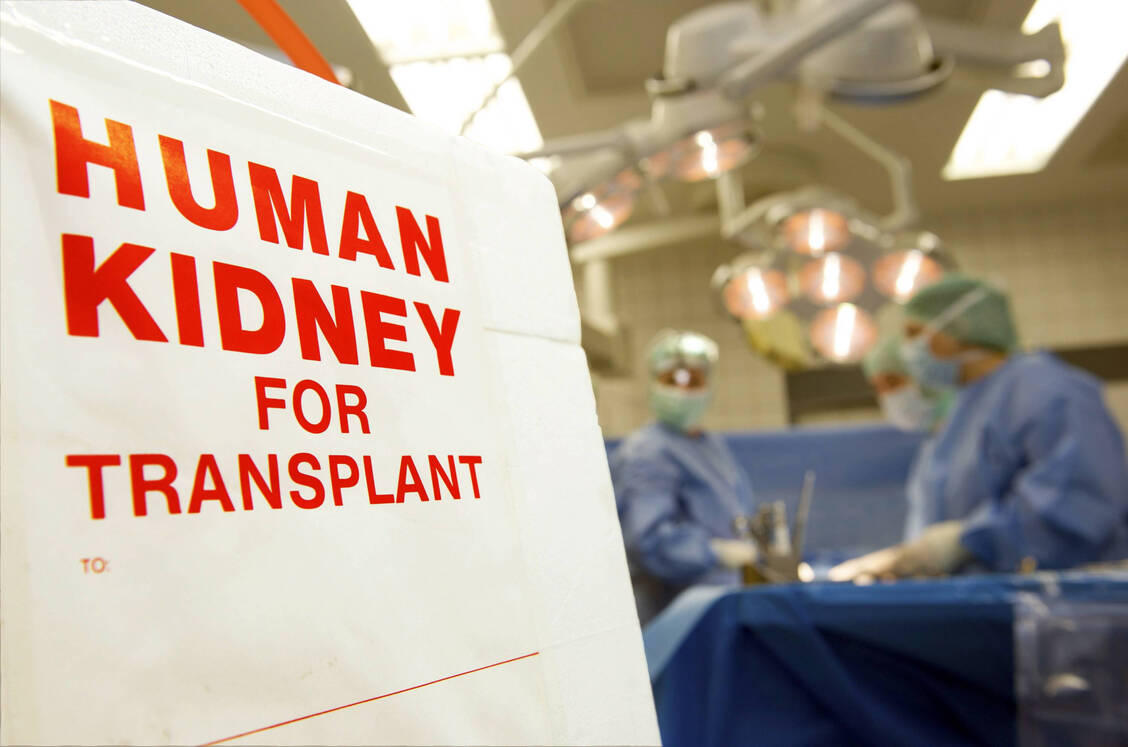Zu den sekundären Endpunkten zählten unter anderem die Ergebnisse von Nierenbiopsien nach 24 und 52 Wochen. Bei der ersten Kontrollbiopsie zeigten sich bei neun von elf Patienten (82 Prozent) im Felzartamab-Arm morphologische Hinweise auf eine Rückbildung der AMR. Dies war in der Placebogruppe nur bei zwei von zehn Patienten zu beobachten (20 Prozent). Auch ein molekularer Score, der die Wahrscheinlichkeit einer AMR angibt, war im Vergleich zur Placebogruppe niedriger (0,17 versus 0,77). Bei drei der neun Patienten, die zunächst auf Felzartamab angesprochen hatten, zeigte sich in Woche 52 ein Wiederauftreten der AMR, was ein Hinweis darauf sein kann, dass eine regelmäßige Therapie mit dem Antikörper nötig ist.