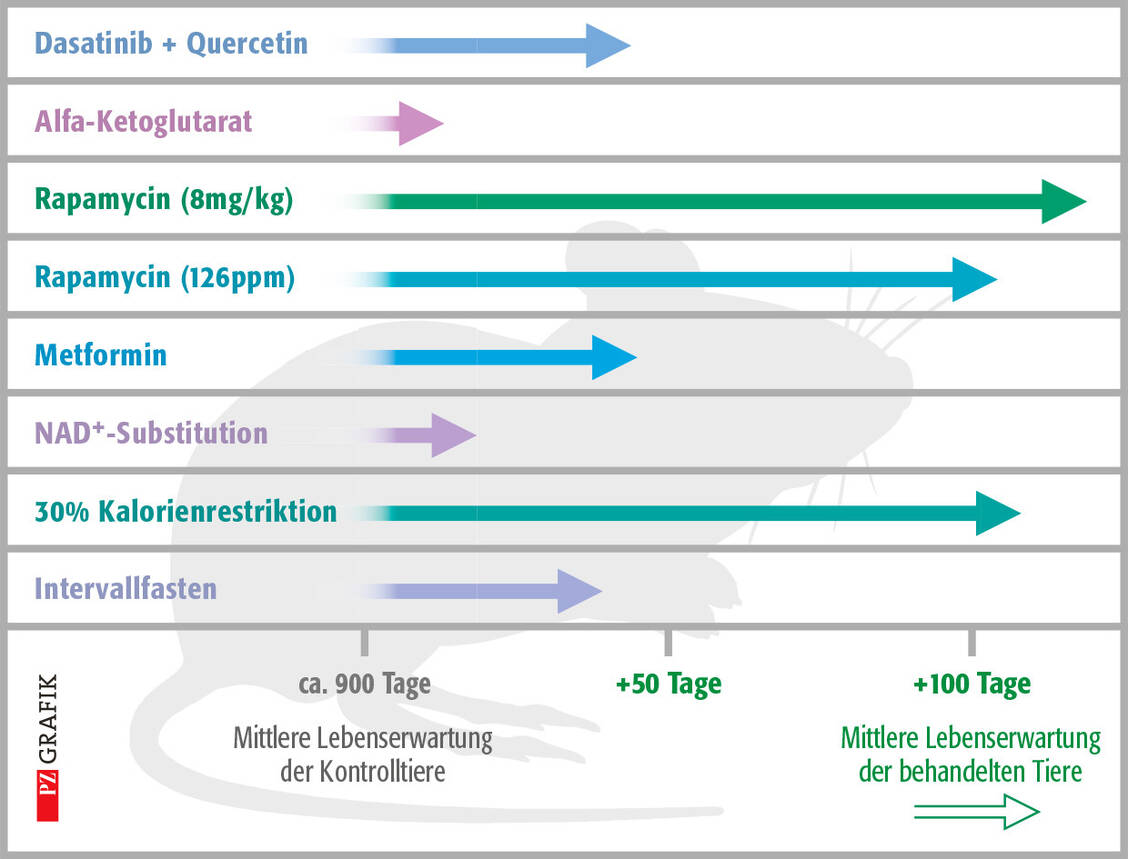Sie verwenden ein Zwölf-Punkte-System, das zu gleichen Teilen zwischen Grundlagen- und klinischen Studien (jeweils sechs Punkte) aufgeteilt ist. Von den sechs Punkten zur Bewertung grundlegender oder präklinischer Faktoren wurden jeweils bis zu zwei Punkte für die Beeinflussung von Alterungsmerkmalen, die Verbesserung der präklinischen Gesundheitsspanne und die präklinische Lebensdauer vergeben (Tabelle). Von den sechs Punkten für die Bewertung der klinischen Aspekte entfallen jeweils bis zu drei Punkte für die Gesundheit und für Mortalitätsdaten. Hinsichtlich der Gesundheit muss das Medikament nachweisen, dass es auf mindestens eine altersbedingte Krankheit oder einen pathologischen Prozess abzielt, für den es nicht zugelassen ist. Bezüglich der Mortalität muss das Medikament nachweisen, dass es die Gesamtmortalität oder den Tod durch eine Krankheit, für die es nicht zugelassen ist, senkt. In diesem Ranking schneiden SGLT-2-Inhibitoren und Metformin mit Abstand am besten ab (Tabelle).