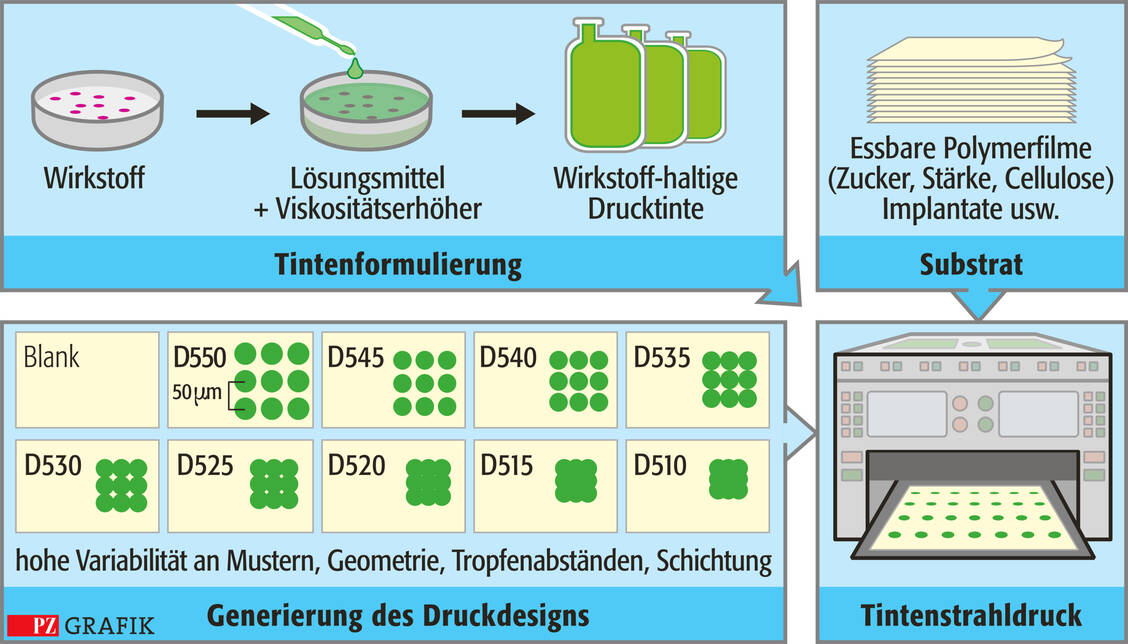Extrusion
Beim Extrudieren werden feste bis zähflüssige Massen, zum Beispiel geschmolzene Kunststoffe, meist mittels einer Förderschnecke unter hohem Druck und häufig auch bei hoher Temperatur kontinuierlich durch eine formgebende Düse gepresst.
Infill
Als Infill bezeichnet man den Teil eines 3-D-gedruckten Objektes, der unabhängig von der äußeren Gestalt das Innenvolumen in frei wählbarer Geometrie und Materialdichte ausfüllt. Bei einem Infill von 0 Prozent ist das gedruckte Objekt hohl, bei 100 Prozent vollständig ausgefüllt.
Sintern
Sintern ist ein Verfahren zur Herstellung oder Veränderung von (Werk-)Stoffen. Dabei werden feinkörnige, polymere, keramische oder metallische Stoffe erhitzt, wobei die Temperaturen unterhalb der Schmelztemperatur der Hauptkomponenten bleiben, sodass die Gestalt (Form) des Werkstücks erhalten bleibt.