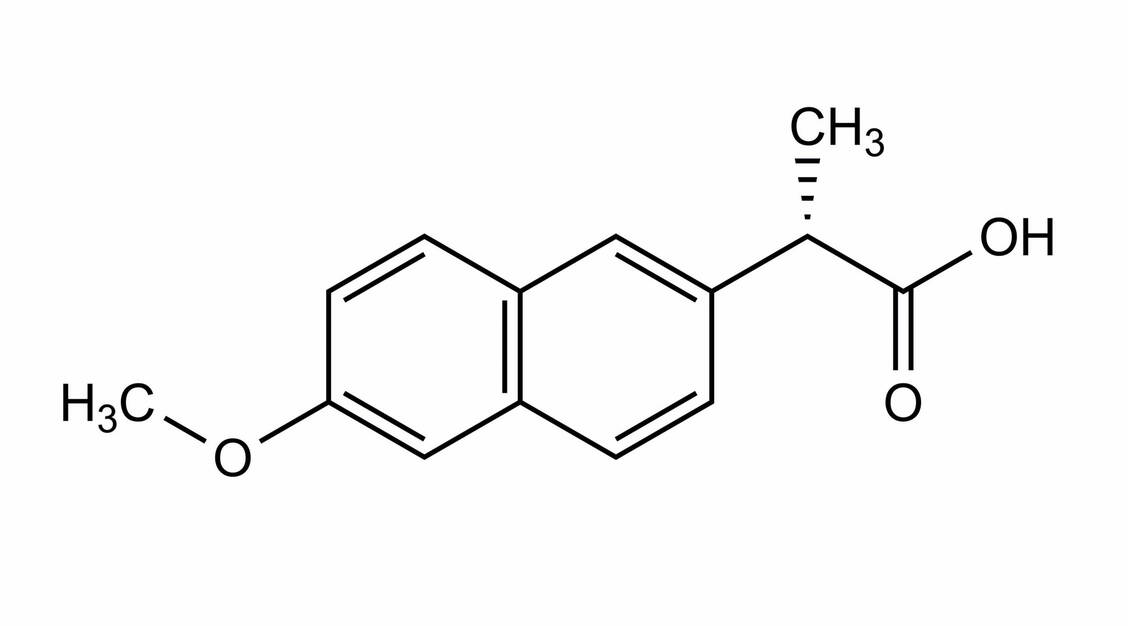Naproxen gilt als das NSAR mit dem geringsten kardiovaskulären Risiko. Sehr häufig sind NSAR-typische gastrointestinale Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Diarrhö, Blähungen, Verstopfung oder Bauchschmerzen, in manchen Fällen auch gastrointestinale Ulcera.
Möglich sind zudem zentrale Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Schwindel, Seh- und Hörstörungen sowie Reizbarkeit und Müdigkeit, was das Reaktionsvermögen beeinflussen kann. Bei Sehstörungen sollte der Patient die Anwendung von Naproxen abbrechen und umgehend einen Arzt informieren. Gleiches gilt, wenn gastrointestinale Blutungen, Nierenprobleme oder Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.
Gelegentlich kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen mit Exanthem, Juckreiz, Purpura oder Ekchymosen kommen. Letztere sind eine Sonderform der Purpura, verursacht durch eine Verletzung kleiner Blutgefäße.
Naproxen macht die Haut lichtempfindlicher, daher ist sorgfältiger Sonnenschutz anzuraten.
Bei Patienten mit Ulcera in der Anamnese, bei Komedikation mit niedrig dosierter Acetylsalicylsäure (ASS) sowie bei Älteren sollte ein begleitender Magenschutz mit Misoprostol oder einem Protonenpumpenhemmer (PPI) in Erwägung gezogen werden.