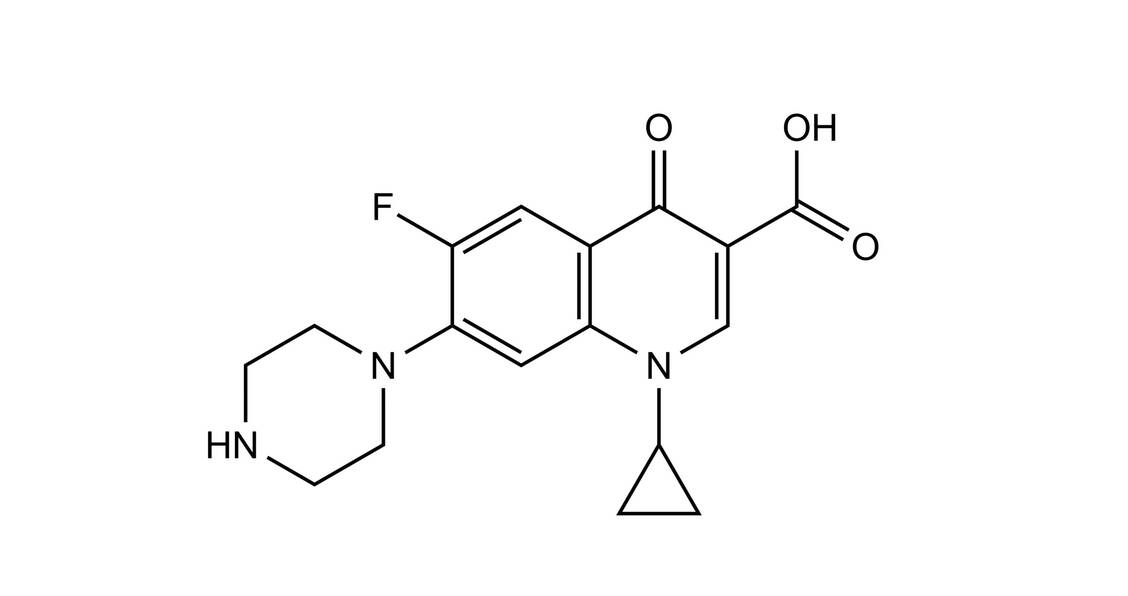Ciprofloxacin gehört zu den wichtigsten Antibiotika und steht auf der Liste unentbehrlicher Medikamente der Weltgesundheitsorganisation (WHO), doch wegen der Resistenzgefahr sowie potenzieller Nebenwirkungen sollen Fluorchinolone nicht mehr bei einfachen Infektionen eingesetzt werden. Zu den gesicherten Indikationen zählen untere Atemwegsinfekte, wenn sie durch gramnegative Bakterien ausgelöst sind und andere Antibiotika nicht infrage kommen, eine akute Verschlechterung der chronischen Sinusitis, wenn sie durch gramnegative Bakterien verursacht ist, Infektionen des Gastrointestinaltrakts wie Reisediarrhö (wirksam gegen Shigellen, Cholera-Bakterien und Typhus), Haut- und Weichteilinfektionen durch gramnegative Erreger, Infektionen der Knochen und Gelenke, Gonokokken-Infektion, Postexpositionsprophylaxe und Behandlung nach Inhalation des Milzbrand-Erregers Bacillus anthracis, Tuberkulose (Teil einer Kombinationstherapie) sowie bakterielle Augenentzündungen (topisch). Bei Mittelohrentzündung kann Ciprofloxacin topisch in Form von Ohrentropfen angewendet werden, bei chronischer eitriger Otitis media auch systemisch. Bei unkomplizierten Harnwegsinfektionen mit gramnegativen Erregern ist Ciprofloxacin nur Mittel der zweiten Wahl.
In der Pädiatrie kommt es außerdem bei Mukoviszidose-Patienten mit bronchopulmonalen Infektionen durch Pseudomonas aeruginosa zum Einsatz sowie bei komplizierten Harnwegsinfektionen und akuter Nierenbeckenentzündung.