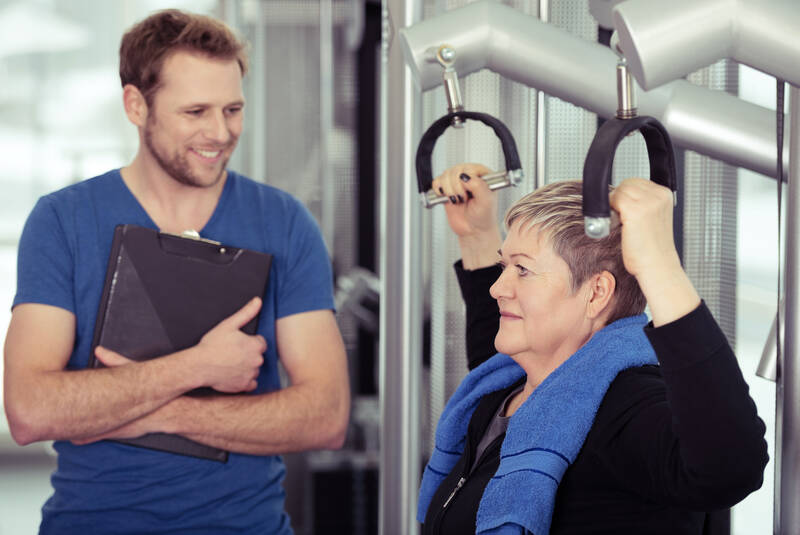Menschen, bei denen ein Trainingsprogramm nicht anschlägt, also keine körperlichen Veränderungen bringt, werden oft als Nonresponder bezeichnet. Neuere Forschungsergebnisse sprechen jedoch dafür, dass es solche untrainierbaren Personen vermutlich gar nicht gibt. Ausschlaggebend sind vielmehr die Art und Intensität des Trainingsreizes: Manche Menschen sprechen beispielsweise auf zweimal wöchentliche Aktivität an, andere erst auf den doppelten Umfang. Bleibt der erhoffte Erfolg aus, so hilft es in der Regel, die Trainingsdauer und -häufigkeit zu steigern. Auch ein Wechsel der Sport- oder Trainingsart kann eine Verbesserung bringen – etwa vom Ausdauer- zum Intervalltraining.
Von Bedeutung ist zudem, welche Zielgröße durch das Training beeinflusst werden soll: Muskelmasse, Ausdauer, Gewicht, Blutfettwerte, Insulinempfindlichkeit oder maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit? Zwar fanden Studien durchaus Unterschiede, ob und wie stark sich einzelne Parameter bei den Probanden verbesserten. Verantwortlich dafür scheinen genetische Unterschiede. Dass sich überhaupt kein gesundheitlicher Effekt zeigte, kam jedoch nicht vor.