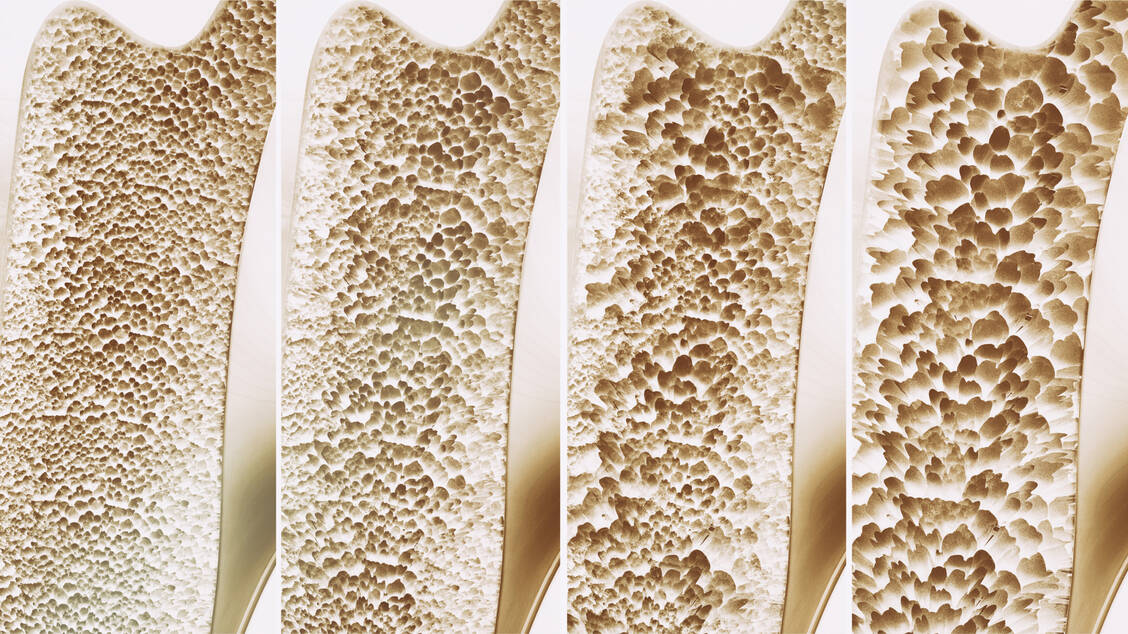Die kürzlich aktualisierte S3-Leitlinie »Prophylaxe, Diagnostik und Therapie der Osteoporose« der DVO empfiehlt für Osteoporosepatienten ohne spezifische medikamentöse Therapie eine Zufuhr von täglich 1000 mg Calcium, die nach Möglichkeit über die Ernährung erfolgen sollte. Besonders wertvoll im Sinn einer knochengesunden Ernährung sind Milchprodukte und Hartkäse. Weitere Calciumlieferanten sind frisches grünes Gemüse wie Brokkoli, Spinat oder Kohl, Obst und Getreideprodukte. Auch Mineralwasser mit einem hohen Calciumgehalt trägt zu einer positiven Bilanz bei.
Zu meiden sind dagegen sogenannte Calciumräuber. Sie hemmen die Calciumeinlagerung in den Knochen, verringern die Resorption aus dem Darm und erhöhen den Abbau der Knochen. Spitzenreiter unter den Calciumräubern ist Phosphat, das sich unter anderem in Cola, Wurst- und Fleischwaren befindet. Koffein bewirkt eine gesteigerte Ausscheidung von Calcium über den Urin. Auch übermäßiger Alkoholkonsum kann das Osteoporoserisiko erhöhen.
Nur wenn die empfohlene Calciumzufuhr mit der Nahrung nicht erreicht wird, sollte der Leitlinie zufolge Calcium supplementiert werden. Standardmäßig empfohlen wird eine solche Supplementierung von täglich 1000 mg Calcium (und Vitamin D, siehe Tipp 2) für Osteoporosepatienten mit einer spezifischen medikamentösen Therapie. Hoch dosierte Einzelgaben seien hierbei nicht empfohlen, so die Autoren. Die beste Resorption kann mit Calciumcitrat erzielt werden, da diese Verbindung keine Magensäure benötigt. Zudem schützt es gegen die Bildung von Nierensteinen und beeinträchtigt nicht die Eisenresorption.
Zu einer knochengesunden Ernährung gehört auch ausreichend Eiweiß. Die aktualisierte Leitlinie empfiehlt neuerdings für Menschen mit erhöhtem Frakturrisiko ab dem Alter von 65 Jahren eine eiweißreiche Ernährung mit einer täglichen Aufnahme von mindestens 1,0 g Eiweiß/kg Körpergewicht/Tag.