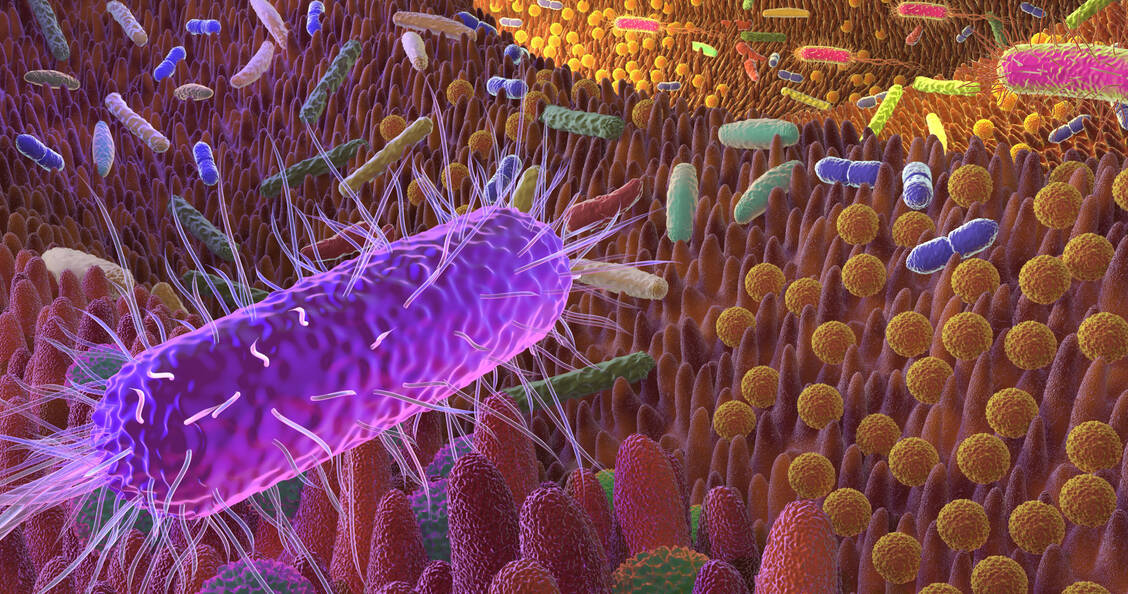Der präfrontale Cortex hat beim Essen ein gewichtiges Wort mitzureden – er wägt ab, plant und kontrolliert –, doch auch das Verdauungssystem spielt eine wichtige Rolle (9). Bereits das Dehnen von Magen und Darm durch den Nahrungsbrei sendet mechanische Signale ans Gehirn und kündigt etwa eine baldige Sättigung an. Zusätzlich kommuniziert der Körper über chemische Botenstoffe. So hemmt die Nahrungsaufnahme die Ausschüttung von Ghrelin, einem appetitanregenden Hormon aus dem Magen. Ghrelin gelangt über das Blut ins Gehirn und aktiviert orexigene Pfade – neuronale Netzwerke, die Hunger und Appetit ankurbeln.
Sobald der Nahrungsbrei den Dünndarm erreicht, setzt die Freisetzung von Inkretinen ein, vor allem die des Glucagonähnlichen Peptid-1 (GLP-1). Es sorgt nicht nur für ein Sättigungsgefühl, sondern reguliert auch den Blutzucker und verlangsamt die Magenentleerung. GLP-1-Rezeptor-Agonisten bekommen aktuell große Aufmerksamkeit und gelten als Hoffnungsträger in der Adipositas-Therapie.
Ein weiteres wichtiges Hormon mit Blick auf Hunger und Sättigung ist Leptin – benannt nach dem griechischen Wort leptos, das »schlank« bedeutet. Wichtig: Leptin ist kein Hormon des Darms, sondern wird hauptsächlich im Unterhautfettgewebe gebildet. Steigen die Fettreserven, nimmt auch die Leptinkonzentration im Blut zu. Im Gehirn angekommen, aktiviert Leptin anorexigene Signalwege, die den Appetit dämpfen und den Energieverbrauch ankurbeln (10).