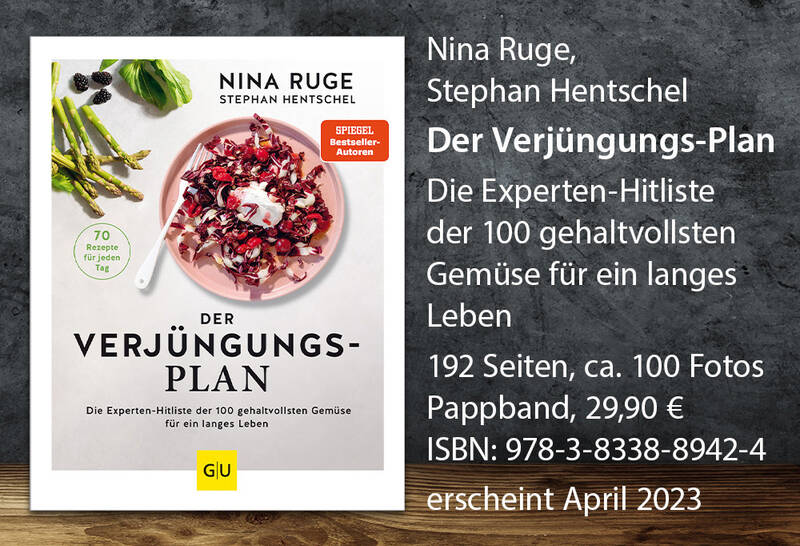Gesunder Lebensstil nutze die Zellphysiologie, um den Zellen einen neuen Schub zu verleihen. Er stärke drei wesentliche »Zellkompetenzen« – wie Ruge es nennt –, und zwar die Zellerneuerung, deren Energieversorgung und ihre Entgiftung. Und es ist ja auch so: Mit der Zeit verlieren Stammzellen an Potenz, zell-eigene Reparatur- und Erneuerungssysteme schwächeln und anfallende senszente Zellen (»Zombiezellen«) sind irreversibel im Zellzyklus arretiert und behindern den Zell-Workflow. Die Dynamik unserer Kleinstkraftwerke, die Mitochondrien, lässt bereits ab 25 Jahren nach, und das vor allem in Geweben und Organen, die sich ohnehin selten erneuern, also Nervenzellen, Herzmuskelzellen, Sinneszellen von Auge und Ohr. Sie verlieren dann pro Jahr etwa ein Prozent ihrer Leistungsfähigkeit. Und die Atmungskette eines 60-Jährigen bringe nur noch die Hälfte ihrer ursprünglichen Leistung, führt Ruge aus. Gleichzeitig fallen verstärkt nicht mehr benötigte und krankhafte Zellbestandteile an, weil Prozesse der Autophagie, also der zelleigenen Recycling-Anlage, weniger effizient arbeiten. So entstehen etwa durch dauerhafte Anlagerung von Glucose an Eiweiß- und Fettverbindungen die Advanced Glycation Endproducts (AGEs). Dadurch verlieren Blutgefäße ihre Elastizität, Muskeln ihre Dehnungsfähigkeit, die Haut wirft Falten.