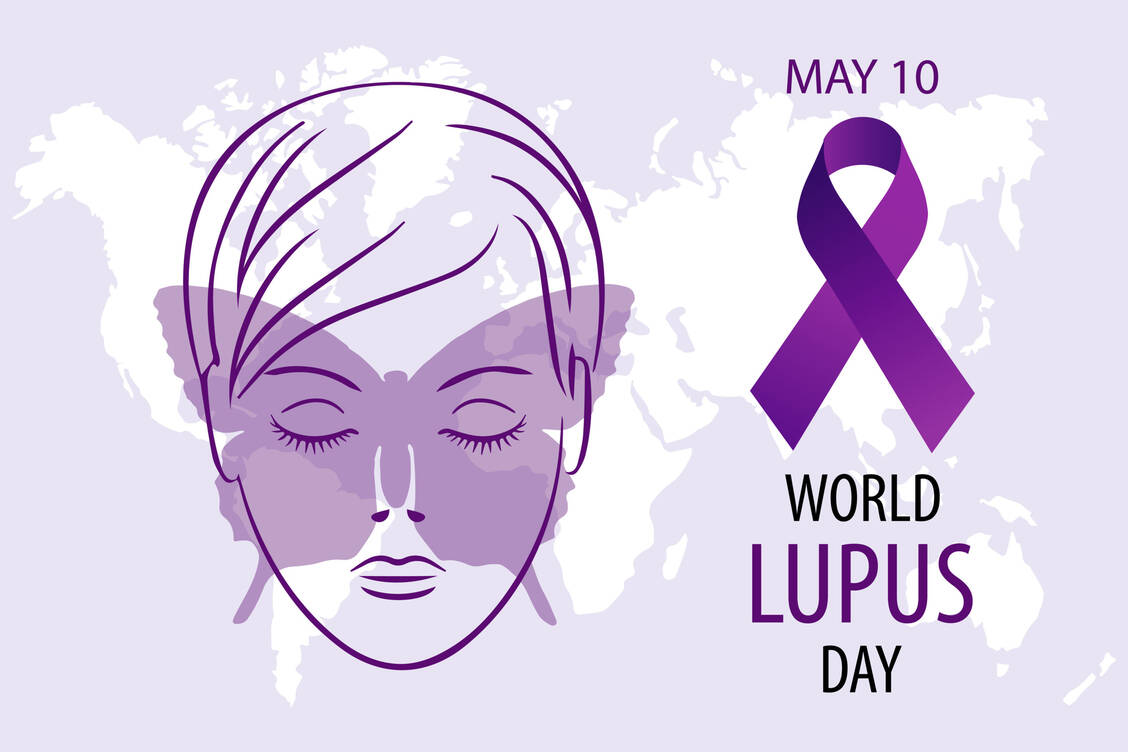Der systemische Lupus erythematodes (SLE) ist eine entzündlich-rheumatische Autoimmunerkrankung, genauer gesagt eine systemische Bindegewebserkrankung (Kollagenose), die zahlreiche Organe, darunter Gelenke, Nieren, Haut, Schleimhäute und Blutgefäßwände betreffen kann. Nach Angaben der Deutschen Rheuma-Liga sind in Deutschland fast eine von 1000 Frauen und einer von 10.000 Männern betroffen; meist sind es junge Frauen zwischen 20 und 40 Jahren. Die Symptome sind vielfältig, wobei eine Lupus-Nierenentzündung die häufigste gefährliche Organbeteiligung darstellt. 40 bis 60 Prozent (je nach Abstammung) der Patienten mit SLE entwickeln im Lauf ihres Lebens eine Lupus-Nephritis.
Eine frühzeitige Diagnose und Therapie kann einem weiteren Verlust der Nierenfunktion bis hin zur Dialysepflicht vorbeugen. Praktisch alle Patienten mit SLE bekommen Hydroxychloroquin (außer bei Glucose-6-Phosphat- Dehydrogenase-Mangel). Nicht steroidale Antirheumatika (NSAR) werden zusätzlich bei leichter Erkrankung eingesetzt. Bei schweren Verläufen werden Corticosteroide, in aktiven Phasen oft als Prednisolon-Stoß, Immunsuppressiva wie Methotrexat, Azathioprin, Mycophenolat-Mofetil und Mycophenolsäure sowie Malariamittel gegeben. Der Antikörper Belimumab ist seit 2021 auch bei aktiver Lupus-Nephritis zugelassen. 2022 kam der Antikörper Anifrolumab in den Handel. Er ist noch nicht bei Lupus-Nephritis zugelassen, sondern ist als Add-on-Behandlung von erwachsenen Patienten mit moderatem bis schwerem, aktivem Autoantikörper-positivem SLE, die bereits eine Standardtherapie erhalten.