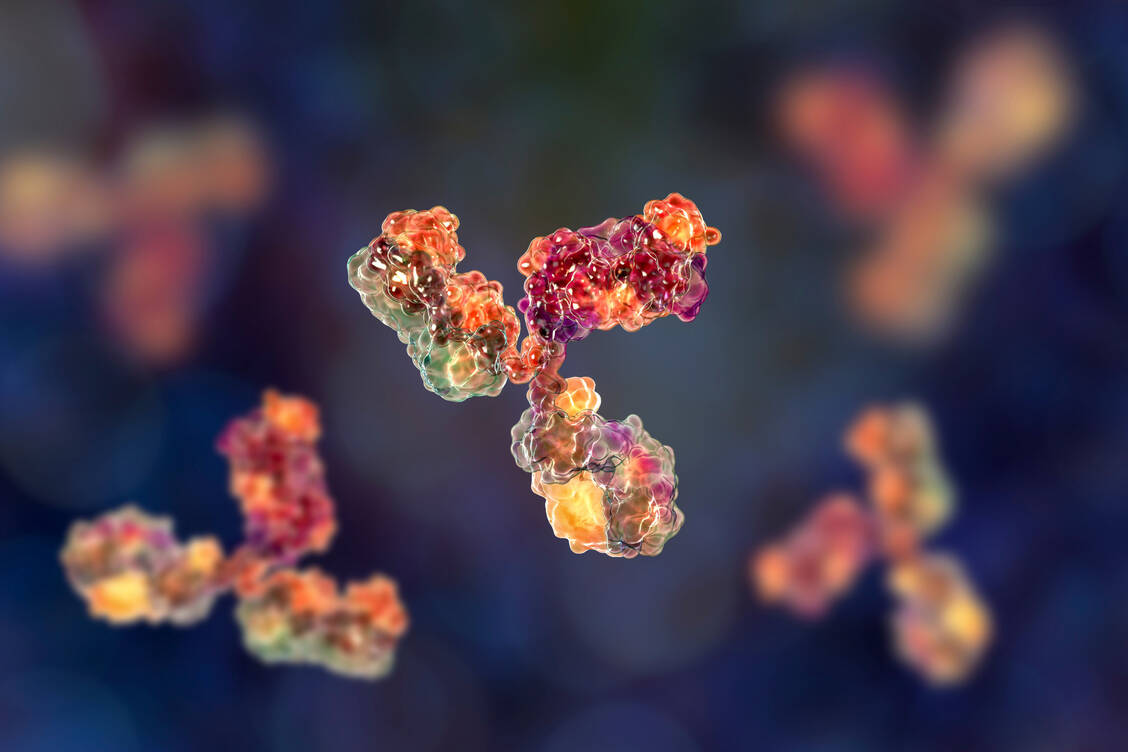Mithilfe von Computersoftware, zum Beispiel der Rosetta Software (12, 13), können neue Proteinfaltungen generiert werden, die anschließend sequenzoptimiert werden. Die Rosetta Software basiert auf einem stochastischen Suchverfahren, das eine Energiefunktion, bestehend aus biophysikalischen und wissensbasierten Komponenten, verwendet, um die Ergebnisse zu evaluieren (14).
Das erste Protein, das durch solch ein computergestütztes Verfahren designt wurde, war im Jahr 2003 »Top7«, das damals eine zuvor noch nicht beobachtete Proteinfaltung aufwies (15). Später stellte sich allerdings heraus, dass diese Faltung in der Natur bereits existierte. Die finale Vision des De-novo-Designs ist, dass Proteine und proteinogene Wirkstoffe zielgenau im Computer ohne aufwendige experimentelle Optimierungen entwickelt werden können.