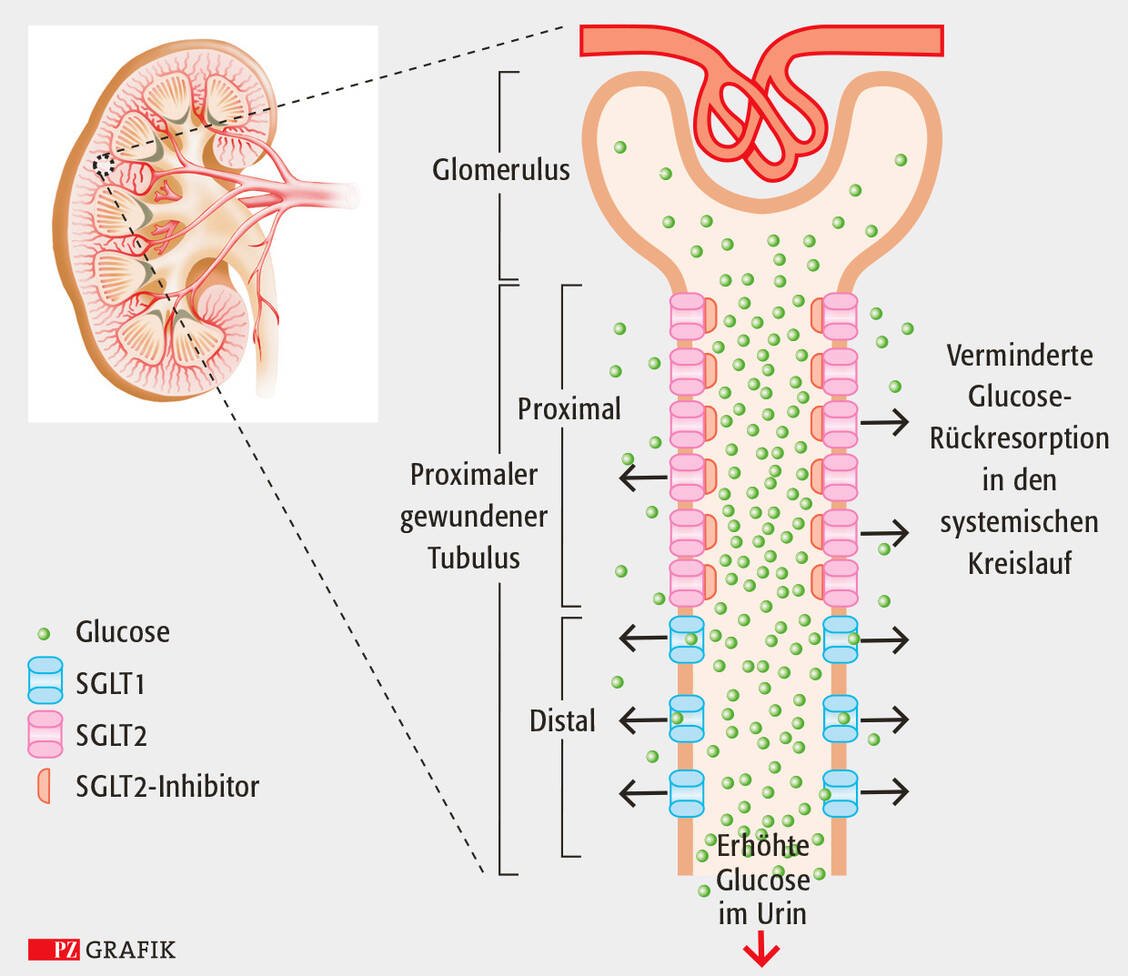Auch in den USA hatte Zynquista-Hersteller Sanofi einen entsprechenden Antrag gestellt. Das zuständige Gremium der FDA kam hier zu einem unentschiedenen Ergebnis: Acht der Berater sprachen sich für eine Zulassung aus, acht dagegen. In ihrer finalen Entscheidung folgte die FDA nun der Argumentation der Skeptiker und lehnte den Antrag auf eine Zulassung von Sotagliflozin bei Typ-1-Diabetes ab. Unter der zusätzlichen Gabe von Sotagliflozin sei es zwar zu einer Abnahme des HbA1c -Werts um 0,3 bis 0,4 Prozentpunkte, der Insulintagesdosis um 4 bis 9 Einheiten und des Gewichts um 2 bis 3 kg in 24 Wochen gekommen. Demgegenüber stand der FDA zufolge aber ein etwa achtfach erhöhtes Risiko für Ketoazidosen. Diese traten in allen Untergruppen auf, am häufigsten bei Patienten, die bereits in der Vorgeschichte eine Ketoazidose entwickelt hatten, bei denen der HbA1c-Wert bei Behandlungsbeginn sehr hoch war, sowie bei Patienten, die eine Insulinpumpe benutzten.