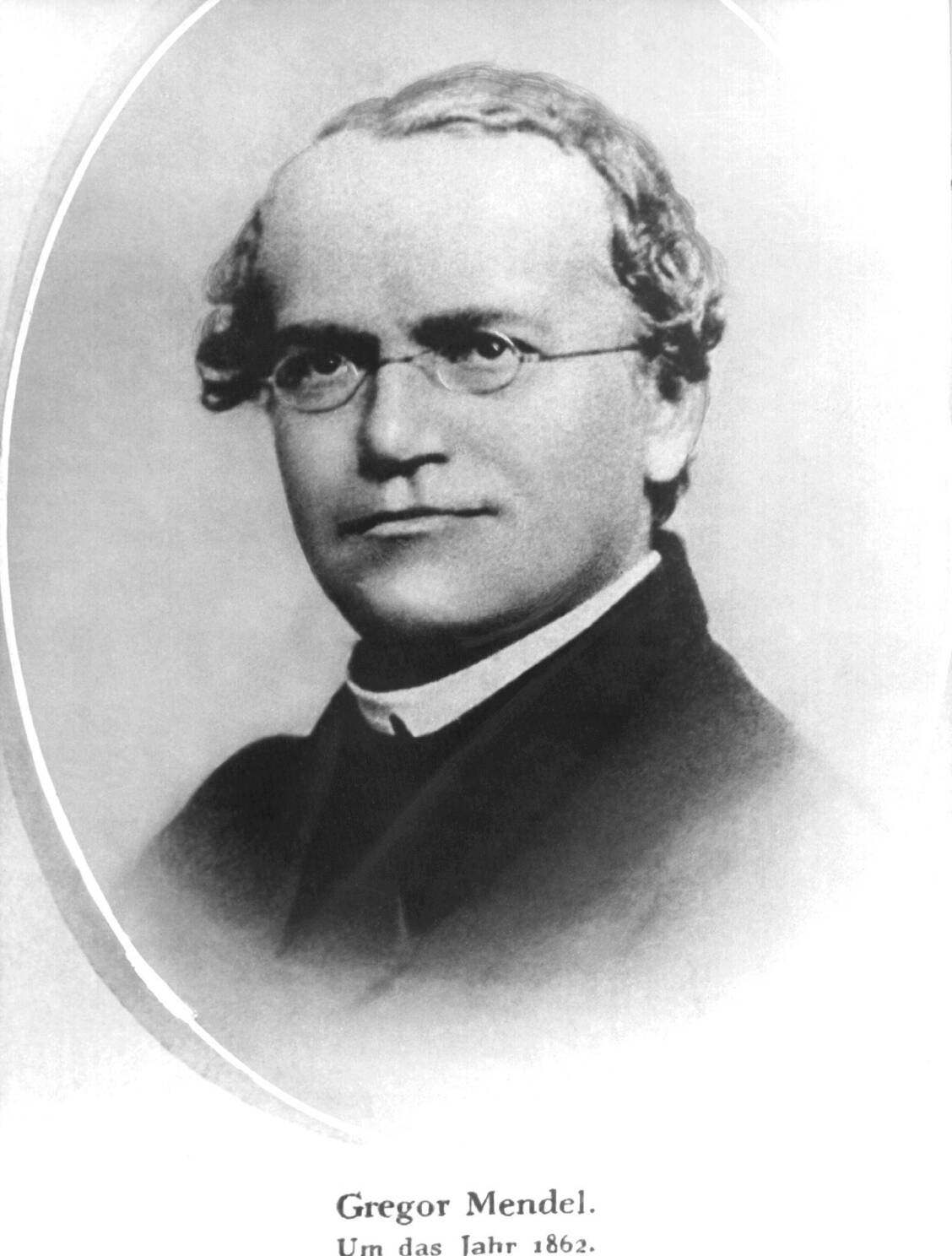Dass Mendel zweifelsohne auch Daten verworfen hat, weil sie nicht zu seinen Hypothesen »passten«, wird ihm von Kritikern zum Vorwurf gemacht. Das ist aber überzogen. Denn man muss berücksichtigen, dass Mendel unter extrem fehleranfälligen Bedingungen forschte. Sein Experimentierraum war ein Wind und Wetter ausgesetzter Klostergarten und kein hochtechnisiertes Gewächshaus. Obwohl er intelligente Verfahren entwickelte, um beispielsweise Windbestäubungen auszuschließen, ist es plausibel, dass das nicht immer gelang. So klappten nicht alle Experimente und in solchen Fällen ist es wissenschaftlich korrekt, die entsprechenden Ergebnisse zu verwerfen, da sie das Gesamtergebnis des Versuchsansatzes extrem verfälscht hätten.