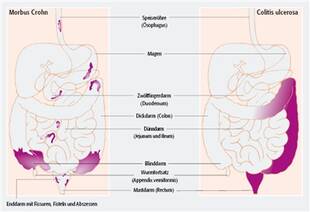Stallmach erklärte, dass nicht eine bestimmte Einzelnoxe zur Störung der gastrointestinalen Barriere bei CED führt. Vielmehr handle es sich um ein multifaktorielles Geschehen, bei dem insbesondere Umweltfaktoren und die genetische Disposition eine wichtige Rolle spielen. Mehr als 200 Gene seien in die Pathogenese der CED involviert.
»Rauchen und MC, das geht gar nicht«, sagte Stallmach. Ein Rauchstopp verbessert den Krankheitsverlauf bei dieser Erkrankung signifikant. Im Fall der CU gibt es dagegen Untersuchungen, wonach Rauchen möglicherweise sogar nützt. Angesichts der vielen schädlichen Wirkungen des Rauchens falle die Nutzen-Risiko-Bilanz jedoch auch bei CU-Patienten negativ aus.
Stallmach stellte zwei unterschiedliche Therapiestrategien bei CED vor: die Top-down-Strategie und das akzelerierte Step-up-Konzept. Während bei der erstgenannten Methode gleich zu Beginn die wirksamsten Medikamente zum Einsatz kommen, wird bei der zweiten die Medikation nach und nach gesteigert, wobei die Aktivität der Erkrankung als Orientierung dient. »Etabliert hat sich das akzelerierte Step-up-Konzept«, sagte der Referent. Warum nicht Top down? Laut Stallmach reichen Basistherapeutika bei 44 Prozent der MC-Patienten und 55 Prozent der CU-Patienten aus. Sofort mit einem Biologikum zu starten, bedeute bei diesen Patienten eine kostenintensive und potenziell nebenwirkungsträchtige Übertherapie.
Bei CU ist laut dem Referenten ohne Zweifel die Gabe von Aminosalicylaten wie Mesalazin und Sulfasalazin Standardtherapie mit guten Kurz- und Langzeitergebnissen. Diese sei auch chemoprotektiv hinsichtlich Darmkrebs. Stallmach: »Der Applikationsweg sollte sich nach dem Befallsmuster der Krankheit richten.« Die topische Therapie mit Klysmen, Suppositorien und Schäumen könne einen zusätzlichen therapeutischen Mehrwert haben.
Steroide im Blick haben
Im Gegensatz zu CU-Patienten sollten MC-Patienten in der Regel direkt Steroide wie Budesonid erhalten. Um die Nebenwirkungen zu minimieren, sollte allerdings mit Corticoiden keine Remissionserhaltung erfolgen. Leider sei es dennoch so, dass mehr als 20 Prozent der CED- Patienten einen chronischen Steroidgebrauch haben. »Hier haben auch Apotheker eine wichtige Kontrollfunktion«, betonte der Mediziner.
Ein hervorragendes Medikament, um Steroide einzusparen, ist dem Referenten zufolge Azathioprin. Der Wirkstoff sei zwar mit einem erhöhten Lymphomrisiko verbunden. Dieses sei aber insgesamt dennoch gering: Statistisch steige die Fallzahl von 2 pro 100 000 Patienten und Jahr auf 8.
Als Biologika haben sich bei CED beispielsweise Anti-TNF-Wirkstoffe wie Infliximab, Adalimumab und Golimumab etabliert. Allerdings verwies Stallmach darauf, dass es auch unter Therapie mit einem Anti-TNF-Antikörper zum Primär- oder Sekundärversagen kommen kann. Zudem sei der Einsatz der Biologika mit hohen Kosten verbunden. Neben weiteren Biosimilars erwartet der Mediziner in der nahen Zukunft eine Vielzahl neuer Medikamente zur CED-Behandlung.