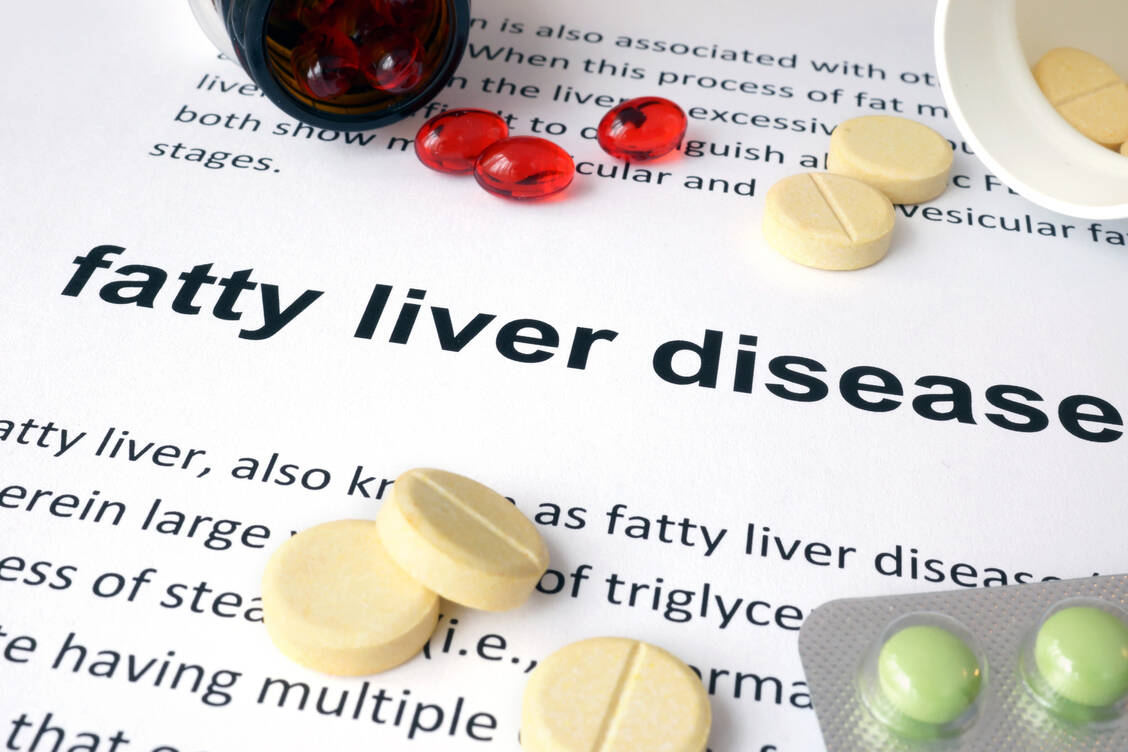Zu weiteren Therapieoptionen heißt es in der Leitlinie: »Der generelle Einsatz von Medikamenten wie Ursodeoxycholsäure, Pioglitazon, Metformin, Silymarin oder Pentoxifyllin sowie Nahrungsergänzungsmitteln wie Vitamin E oder Omega-3-Fettsäuren soll aufgrund der aktuellen Datenlage zur Behandlung der NAFLD nicht erfolgen.« Demnach führe Vitamin E (Dosis > 400 IE/Tag) bei langfristiger Einnahme zu erhöhter Gesamtmortalität und bei Männern zu einem erhöhten Risiko für Prostatakrebs. Omega-3-Fettsäuren, Silymarin und Polyphenole oder Ursodeoxycholsäure und Pentoxifyllin zeigten keine signifikanten Gewebeverbesserungen bei NAFLD. Studiendaten zur Supplementation von Spurenelementen und zum Einsatz von Phytopharmaka bei NASH seien gar nicht beziehungsweise kaum verfügbar.