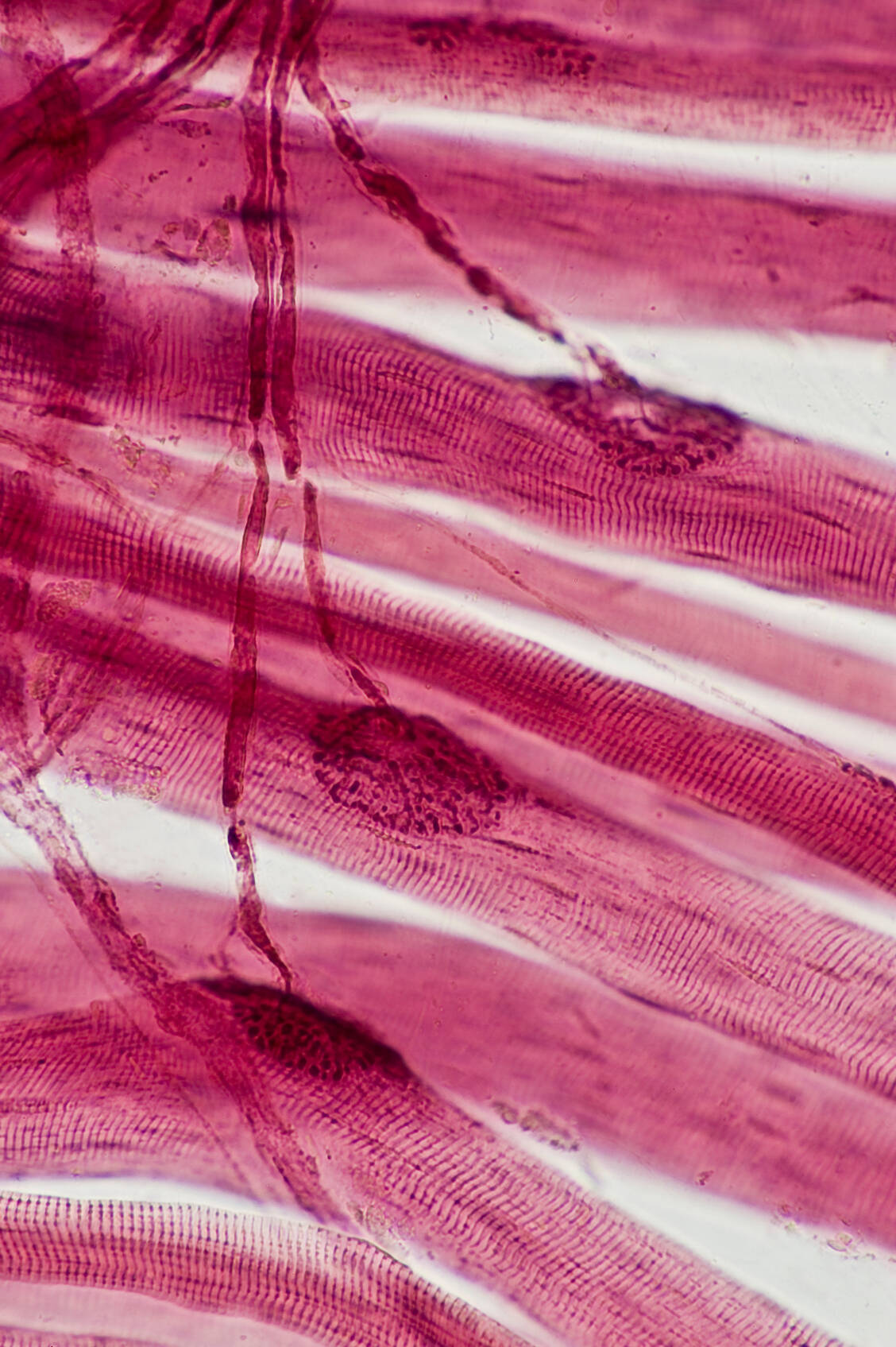Beide neuen Arzneistoffe bei Myasthenia gravis sind vorläufig als Schrittinnovation zu betrachten. Bei Rozanolixizumab ist es nicht das Wirkprinzip, das zu dieser Einstufung führt. Denn der Wirkstoff ist nach Efgartigimod alfa schon der zweite, der auf FcRn abzielt. Allerdings weist Rozanolixizumab ein breiteres Anwendungsgebiet auf, weil er auch bei Patienten mit Anti-MuSK-Antikörpern zum Einsatz kommen darf. Für diese bringt die Markteinführung von Rystiggo einen Therapiefortschritt und daher ist die Einstufung bei den Schrittinnovationen auch gerechtfertigt. Besonders positiv ist in diesem Zusammenhang, dass Patienten mit Anti-MuSK-Antikörpern sogar noch etwas besser auf Rozanolixizumab ansprechen als Anti-AChR-positive Patienten. Bislang ist Rozanolixizumab nicht für die regelmäßige Gabe zugelassen. Abhängig von weiteren Studienergebnissen wird man aber vielleicht eines Tages von der Therapie in Zyklen zu einer regelmäßigen Gabe übergehen können.
Zukunftsmusik ist zurzeit auch noch die Kombination aus FcRn-Blockade und einem Komplementinhibitor. Pathophysiologisch wäre das sinnvoll, auch wenn man dabei immer die Sicherheit besonders im Blick behalten sollte. Es wäre interessant zu wissen, ob Patienten mit hochaktiver Erkrankung von einer solchen Kombination weiter profitieren. In der Praxis stellt sich die Frage danach derzeit schon aufgrund des Preises der Medikamente ohnehin nicht. Das heißt, Ärzte werden sich bei geeigneten Patienten entweder für einen FcRn-Blocker oder einen Komplementinhibitor entscheiden.
In die letztgenannte Klasse ist der zweite Neuling Zilucoplan einzuordnen, der ebenfalls eine Schrittinnovation darstellt. Das Wirkprinzip weist zwar Ähnlichkeiten mit jenem von Eculizumab und Ravulizumab auf, der Neuling bindet aber an einer anderen Stelle am Komplementprotein C5. Hinzu kommt, dass Zilucoplan subkutan appliziert wird und nicht infundiert werden muss. Zudem weist es anders als die Antikörper eine weitere Wirkkomponente, eine Art zweite »Reißleine«, auf. Sollte das C5b-Fragment gebildet werden, so verhindert Zilucoplan dessen Bindung an C6, was nachfolgende Schritte in der Komplementkaskade blockiert.
Da es bisher keinen direkten Vergleich mit den Antikörpern gibt, lässt sich die Frage, ob Zilucoplan vielleicht sogar wirksamer ist, derzeit nicht beantworten. Derartige Untersuchungen wären wünschenswert, auch hinsichtlich der Verträglichkeit. Denn möglicherweise sind die Antikörper, weil sie größer sind, auch immunogener als das vergleichsweise kleine Molekül Zilucoplan.
Sven Siebenand, Chefredakteur