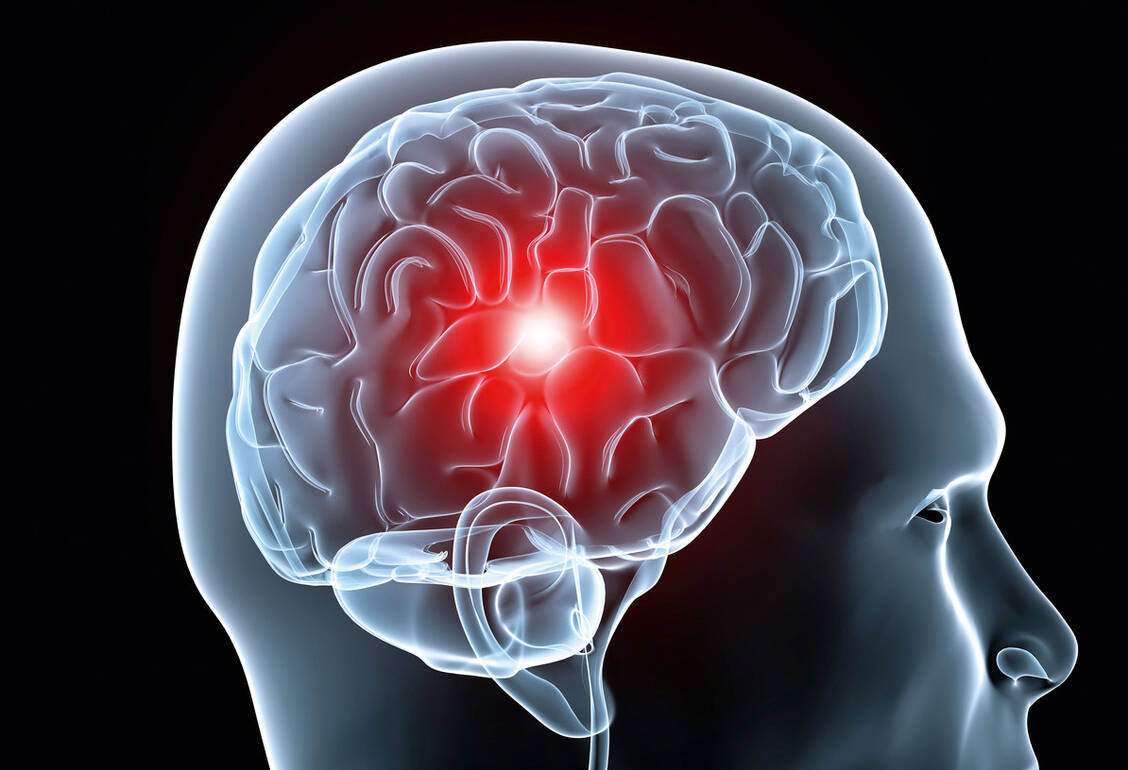Sie sahen, dass sich rund um die Krebszellen, die sich in den Hirnkapillaren festgesetzt hatten, häufig Blutgerinnsel bildeten. Ohne ein solches Gerinnsel schafften es die Krebszellen nicht, die Kapillarwand zu durchdringen. Dabei griffen die Tumorzellen offenbar direkt in die Blutgerinnungskaskade ein, indem sie die Entstehung des Gerinnungsfaktors Thrombin förderten. Die Hemmung von Thrombin mit niedermolekularem Heparin oder Dabigatran (Pradaxa®) sowie die Gabe eines Antikörpers, der gegen den Blutgerinnungsfaktor von Willebrand-Faktor (VWF) gerichtet war, verhinderte bei den Mäusen sowohl die Gerinnsel- als auch die Metastasenbildung. Dieser Effekt blieb nach Gabe von Arzneistoffen, die die Thrombozytenaggregation hemmten, dagegen aus.