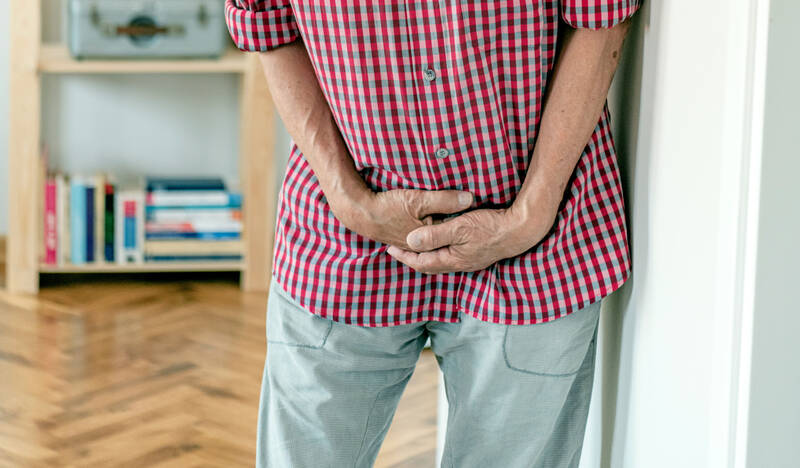Die autonome Neuropathie betrifft das vegetative Nervensystem, also jene Nervenbahnen, die lebenswichtige Funktionen wie Herzschlag, Blutdruckregulation und Blutzuckerhaushalt unbewusst steuern (23). Auch die Steuerung von Verdauung und Blasenfunktion, Schweißsekretion, Pupillenreaktion auf Lichtreize sowie Prozesse im Sexual- und Reproduktionssystem werden vegetativ gesteuert.
Entsprechend breit gefächert ist das klinische Bild einer autonomen Neuropathie. Die Symptome können nahezu jedes Organsystem betreffen – eine oft erhebliche Einschränkung der Lebensqualität und hohe seelische Belastung.
Besonders häufig ist das Herz-Kreislauf-System betroffen, etwa durch inadäquaten Pulsanstieg bei Belastung, dauerhafte Tachykardie in Ruhe oder orthostatische Hypotonie. Schmerzempfindungen können vermindert sein. So kann zum Beispiel ein Herzinfarkt unbemerkt bleiben.
Im Magen-Darm-Trakt führen gestörte Bewegungsabläufe zu Symptomen wie Gastroparese, Übelkeit, Erbrechen, Völlegefühl, chronische Obstipation und nächtliche Durchfälle. Auch die Blasenentleerung kann gestört sein. Unvollständige Entleerung, Harnwegsinfekte oder Inkontinenz sind die Folge.
Die Schweißdrüsen können paradox reagieren: Manche Patienten schwitzen nachts stark, aber tagsüber kaum, was das Risiko der Überhitzung erhöht.
Auch die Sexualfunktion leidet häufig. Männer entwickeln Erektions- und Ejakulationsstörungen, Frauen berichten über verminderte Erregbarkeit und Orgasmusstörungen.