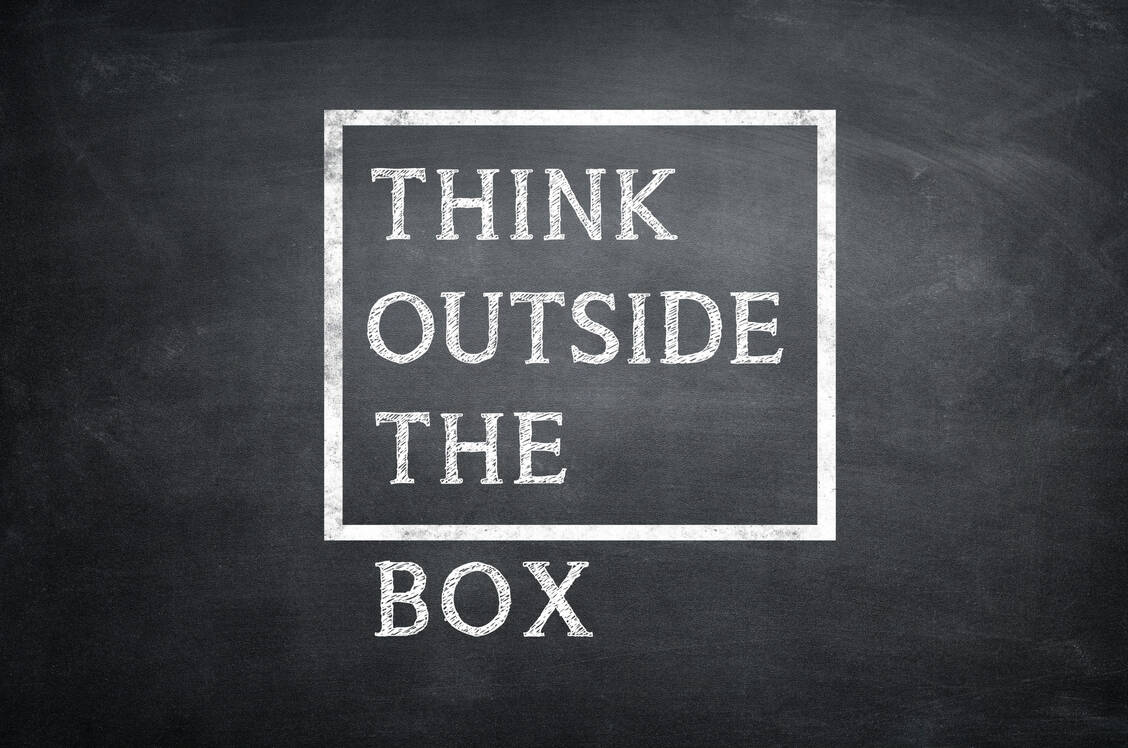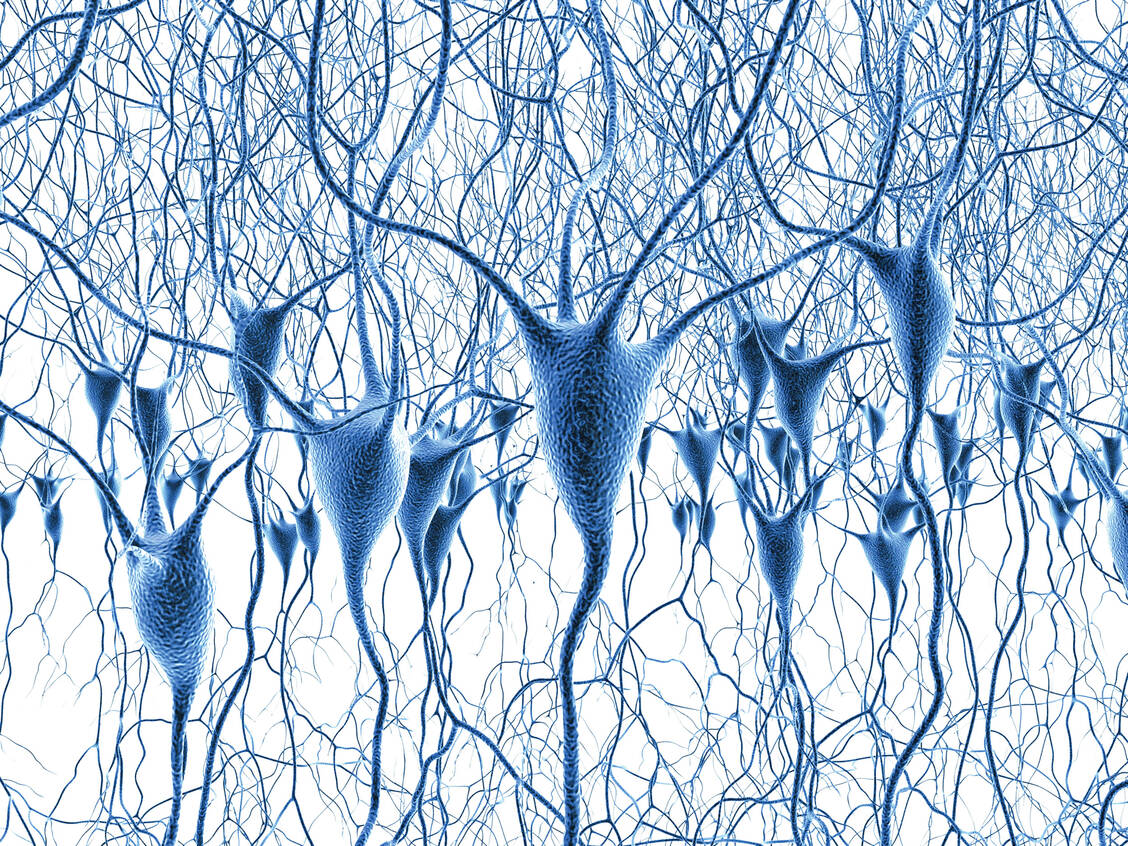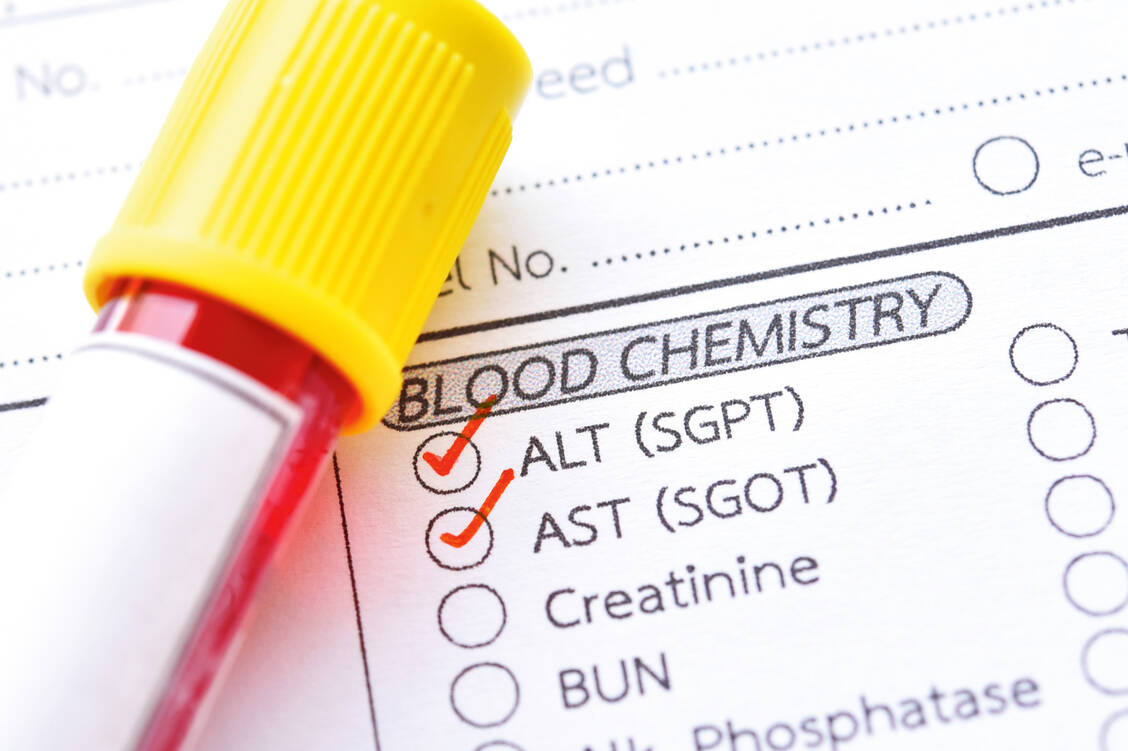Laut einer Publikation chinesischer Wissenschaftler der Huazhong University of Science and Technology in Wuhan in »Jama Neurology« sind neurologische Symptome bei SARS-CoV-2-Infizierten nicht selten (DOI: 10.1001/jamaneurol.2020.1127). 78 von 214 untersuchten Covid-19-Patienten, also 36,4 Prozent, zeigte den Forschern zufolge Anzeichen dafür, dass das Virus das Nervensystem geschädigt hatte. Dabei war bei knapp einem Viertel aller Patienten das zentrale Nervensystem (ZNS) betroffen und bei 9 Prozent das periphere Nervensystem. Bei Patienten mit ZNS-Manifestationen wurden am häufigsten Schwindel und Kopfschmerz beobachtet, Folgen einer Beteiligung des peripheren Nervensystems waren Riech- und Geschmacksstörungen.